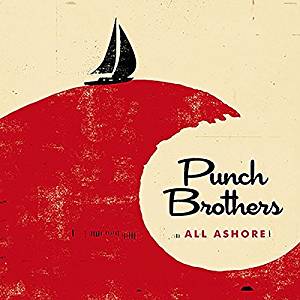 Punch Brothers
Punch Brothers
All Ashore
(Nonesuch/Warner)
Von Produzenten, und der letzte war immerhin T-Bone Burnett, haben sich die fünf Amerikaner auf ihrem sechsten Album losgesagt. Doch auch in Eigenregie setzen die „Brüder“ ihren sehr elaborierten Kammer-Country fort: Noch delikater sind die Satzgesänge, noch verinnerlichter Chris Thiles Leadvocals. Grandios groovy, aber auch intellektuell wie nie das Teamplay zwischen den gezupften und gestrichenen Strings, mit der aberwitzig virtuosen Mandoline im Fokus. Die herkömmlichste Songstruktur hat noch der swingende „Jumbo“, voll ätzenden Spotts über einen White & Male-Profiteur. Nicht nur das siebenminütige Titelstück birgt eine kleine Suite für sich: „The Angel Of Doubt“ ist Pizzicato-Dramolett, akustischer HipHop und verzerrter Folkwalzer zugleich. Diese Tempi- und Taktwechsel!
„Jungle Bird“ klingt zunächst als würde es jede Tanzscheune zwischen den blauen Bergen und Oklahoma in Brand setzen, zerbröselt dann aber in purer Lust an der Dekonstruktion. Als Konzeptwerk kann man das Werk auch sehen: Thile ließ verlauten, es gehe in den Texten um die Isolation und Zerstreuung in der digitalen Ära, und um das, was an Verbindlichkeiten und Beziehungen im politischen Klima der Staaten gerade noch übrigbleibt. Philosophisch sind die Punch Brothers da durchaus ihren Popkollegen von den Fleet Foxes verwandt. Ist das noch Bluegrass, noch Americana? Diese Scheibe aktiviert phasenweise eher Hirnregionen, wie sie etwa beim Hören eines spätromantischen Streichquintetts angesprochen werden.
© Stefan Franzen

 Olivia Chaney
Olivia Chaney Fatoumata Diawara
Fatoumata Diawara Dobet Gnahoré
Dobet Gnahoré Stefano Bollani
Stefano Bollani


 3MA
3MA