
Lady Blackbird
Black Acid Soul
(Foundation Music/BMG)
Zwei Akkorde, pendelnd wie ein sanft angestoßenes Glockenwerk. Darüber glitzernde Tröpfchen der Improvisation, ein ruhig schreitender Bass darunter. Das Klavier scheint aus einem riesigen Saal herauszutönen. Und dann: diese großartige Stimme, rau und doch besänftigend, man will sich in sie hineinbetten. „Wenn du ganz verloren bist, verfinstert und geschunden, wenn dein Herz unter Anklage steht, dann werde ich das für dich in Ordnung bringen. I will fix it for you.“ Die dunkle Stimme in diesem Trostlied für Erwachsene, das auf dem „Peace Piece“ des Pianisten Bill Evans beruht, gehört Marley Munroe aus L.A. Unter dem Pseudonym Lady Blackbird erwirbt sie sich gerade den Ruf als eine der aufregendsten Newcomerinnen im Vokalfach.
Als sie den jetzigen Namen noch nicht trug und in New York wirkte, durchlebte Munroe eine andere Klangwelt. Ihre Musik tönte knallig und überproduziert, R&B-Stangenware mit Drum-Maschinen, E-Gitarren und schwülen Strings, sie inszenierte sich als Vamp, auch gerne mal mit SM-Maske. Zuvor hatte sie in Nashville christliche Musik gemacht, getreu ihren Wurzeln im Gospelgesang. Der Schwenk kam durch die Begegnung mit dem Produzenten Chris Seefried, mit dem sie in den Sunset Sound Studios von Hollywood eine völlig neue Philosophie erarbeitete. Und die hieß: radikale Reduktion. Ein Steinway-Flügel im Hallraum, eine auf Sparflamme zischende Orgel und der faserige Hauch des Mellotrons (für alle verantwortlich: Deron Johnson), sowie der souveräne, virile Bass von Jon Flaugher: Kaum mehr braucht es. Wenige Male wird ein abgespecktes Schlagzeug bemüht, spartanische Gitarrentöne, einmal die Trompete von New Orleans-Größe Trombone Shorty. Denn so bleibt die Lady mit ihrer Stimme im Spotlight, mal tröstlich im Pianissimo, oft aber verletzt und fiebrig. Und in den exaltierten Passagen wie ein akustischer Wundbrand, der sich in die Seele der Hörenden fräst.
Lady Blackbird fasst ihren Liedzyklus unter dem Titel Black Acid Soul, der weniger ein Stilbegriff als eine Haltung ist. „Diese Aufnahme wurde zur Welt gebracht in L.A., aber getragen wird sie vom weltweiten Geist der untergründigen schwarzen Musik“, schreibt sie in den Liner Notes der CD. Trotz dem Mangel an Eigenkompositionen ist Black Acid Soul kein Cover-Album. Denn das kleine Team erfindet all die reinterpretierten Songs neu, destilliert aus ihnen die Essenz des Zeitlosen. Mehr noch: Es kommt einem vor, als seien die Originale, 50, 60 Jahre alt, bisher nur halb geöffnete Blüten gewesen, die sich erst jetzt ganz entfalten. Da ist erst einmal das namensgebende Stück „Blackbird“: Nina Simone hat es 1963 bereits gesungen, a cappella, als schmerzliches Porträt der schwarzen Frau in einem rassistischen Amerika, die sich in die Freiheit nicht emporschwingen kann. Zwar hat Munroe es vor dem George Floyd-Trauma eingesungen, aber unfreiwillig wird es bei ihr jetzt zum Soundtrack für den Rückfall Amerikas. Die finale Textzeile ein Aufschrei, wie eine Verurteilung: „You Ain’t Never Gonna Fly!“
In den Southern Soul-Nummern „It’s Not That Easy“ und „Ruler Of My Heart“ (ursprünglich von Reuben Bell und Irma Thomas) verzichtet sie auf Bläser oder Chöre und schraubt nur mit ihrer Solo-Stimme das Klage-Potenzial enorm hoch. Ähnliche Konzentration der Mittel in „Collage“: Für das Original spannte die James Gang aus Ohio noch gleißende Streicher ein, Lady Blackbird gestaltet es mit raffinierten vokalen Overdubs und ein paar peitschenden Beckenschlägen dramatisch aus. Und Tim Hardins Ballade „It’ll Never Happen Again“, einst eine recht verträumte Folkballade, reinkarniert hier in großen Soul-Phrasierungen als verzweifelte Hymne des Entliebens. Wie sich hier der Geist einer Ära erneuert, die sich von Sam Cooke bis zum Psychedelic Rock zieht, erfasst man beim Hören ganz intuitiv. Oder besser: Man wird erfasst von diesem Geist, eingehüllt. Denn Black Acid Soul macht süchtig.
© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung vom 1.2.2022

 Foto: Urszula Las
Foto: Urszula Las Elza Soares & Riachao (Foto: Wikimedia Commons)
Elza Soares & Riachao (Foto: Wikimedia Commons)





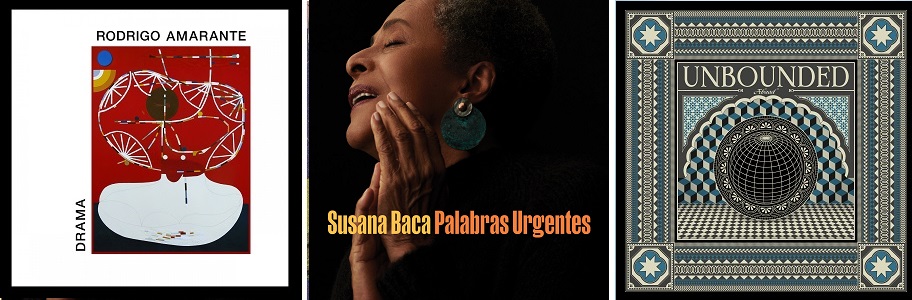
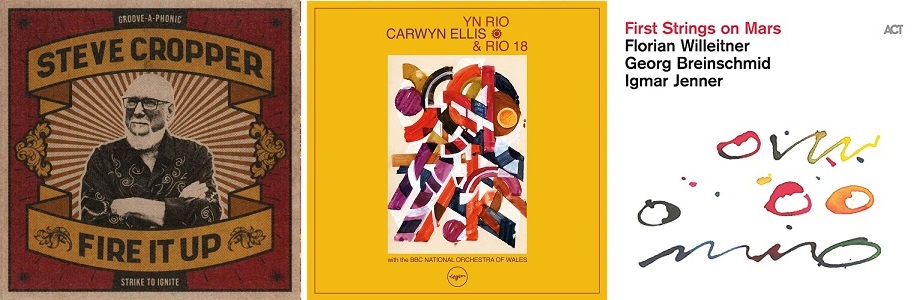


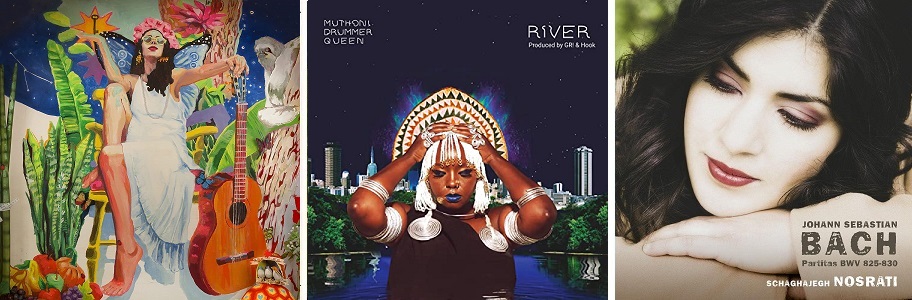
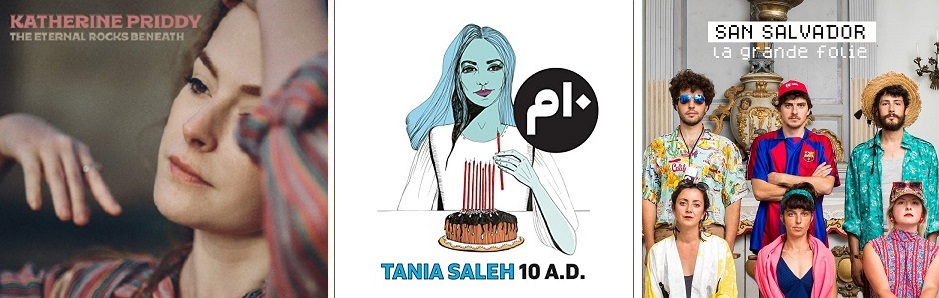
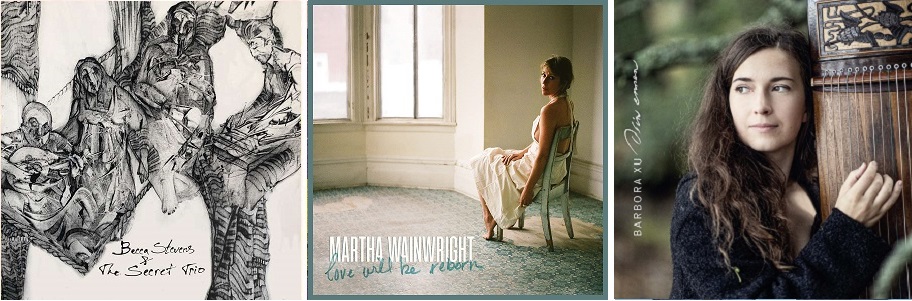
 Renaud García-Fons
Renaud García-Fons