 Milton Nascimento
Milton Nascimento
Kaufleuten Zürich
19.06.2019
Einige der ergreifendsten Momente meiner Brasilien-Rezeption verdanke ich Milton Nascimento. Dazu zählen besonders seine lyrischen Songs der beiden frühen Clube da Esquina-Alben von 1972 und 1978. Als bekannt wurde, dass der mittlerweile 76-Jährige genau diese Songs auch in Europa noch einmal auf die Bühne bringen würde, war die Freude sehr groß. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, wenn eine Legende nach Jahrzehnten nochmals in die Frühzeit der Karriere abtaucht, es kann zur selbstreferenziellen Cover-Show geraten, doch im besten Fall kann überraschend Neues aus dem alten Material erstehen. Wie hat das in Zürich funktioniert?
Ganz am Anfang müssen wir über die Gesundheit des Künstlers sprechen: Milton war schon lange von Krankheiten geplagt, musste in den letzten Jahren auch mal Konzerte abbrechen. Auch im Kaufleuten ist gleich klar, dass es nicht zum Besten um ihn steht. Er wird vom zweiten Sänger und Gitarristen Zé Ibarra auf den Hocker geleitet und bleibt dort die ganze Show über mit dunkler Brille sitzen. Seine Stimme ist brüchig und nicht mehr trittsicher, doch er war nie ein Meister der reinen intonation. Was in seinen Vocals zählt, ist die hohe Kunst der Innerlichkeit, der fast gebetshaften Schmerzlichkeit, die in Hymnen wie „Claréia“ immer noch phasenweise durchleuchtet.
Das Septett, das Milton für diese Retro-Show zusammengestellt hat, macht seine Arbeit zweckdienlich, in den richtigen Momenten tritt die E-Gitarre von Wilson Lopez mit nachdenklich mäandernden Soli hervor, wie das einst Toninho Horta tat, Widor Santiago setzt mal folkloristische Akzente mit Flöte, mal geht er mit Sax – mehr als das die Clube da Esquina-Band je tat – aufs jazzige Parkett. Der Anfang ist holprig, gerade der Bandleader muss sich erst finden, doch ab dem rhythmische Haken schlagenden „Cravo E Canela“ stimmt die Synergie der acht Akteure. Milton baut einen spanischsprachigen Block ein, zeigt sich als ein Cancionero, der immer den ganzen südamerikanischen Kontinent ansprach und findet besonders hier mit der Band zu einer effektvollen, rockig-dramatischen Steigerung.
In der Mitte verlässt Milton zeitweilig die Bühne, und als Glockenschläge von der Percussion kommen, ist klar, dass Zé Ibarra die Leadstimme in „San Vicente“ übernimmt: Dieses genauso ergreifende wie mysteriöse Lied, getragen von Anleihen an Kirchengesänge, hätte der Altmeister nicht mehr gepackt. Ibarra singt die innige Hymne mit einer sehr reinen, weichen, fast zu geschmeidigen Stimme, die in der Música Caipira, Brasiliens schmalzigem Country-Genre, auch gut aufgehoben wäre. In anderen Stücken wechselt er sich mit Milton strophenweise ab, doch die kantige, poetisch dadurch umso charakterstarke Stimme des ehemaligen Esquina-Vokalpartners Lô Borges kann er nicht ersetzen.
Als Milton zurückkehrt, kann das Septett nochmals aus dem grandiosen Katalog der frühen Songs schöpfen: „Nuvem Cigana“ mit seinen eigentümlichen Akkordfolgen und „Paisagem Da Janela“ reihen sich aneinander, schließlich das träumerische „Trem Azul“, das vom Publikum – mit hochprozentigem brasilianischem Anteil – begeistert mitgesungen wird. Der „blaue Zug“, er bricht hier für viele ältere Zuhörer zur Museumsfahrt in die Siebziger auf. Leider ist die Luft ab da raus: „Maria, Maria“ und das zweite schöne Eisenbahnlied über die stillgelegte Strecke, „Ponto Final“, kann Milton nur noch erschöpft anstimmen. Was bleibt, ist ein zwiespältiger Eindruck: Milton Nascimento, nicht mehr auf der Höhe seiner Kräfte, hat den Versuch gewagt, den Kern seiner Schaffenskraft nochmals hochleben zu lassen. Eine stabile Band und viel Herzblut des Hautpakteurs haben einen meist würdigen Nostalgie-Abend auf die Bühne gebracht, bei dem das Ursprungsmaterial kaum angetastet wurde – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
© Stefan Franzen








 Maria Gadú & Tribalistas
Maria Gadú & Tribalistas






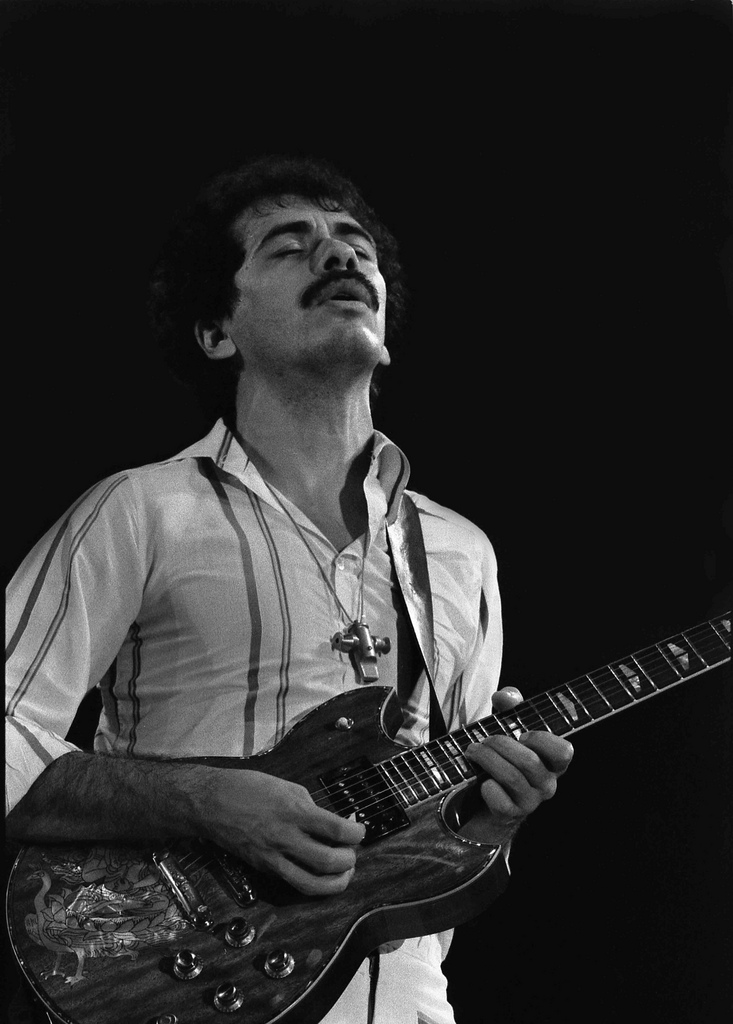 Foto: Chris Hakkens
Foto: Chris Hakkens