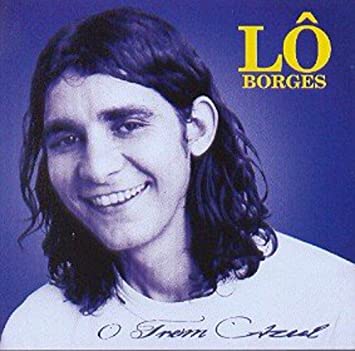Joyce & Mauricio Maestro in den Columbia Studios, New York 1977 (credits: Raymond Ross)
Angehender Brasil-Star trifft weltberühmten deutschen Produzenten in New York. Das Resultat: Eine legendäre Session in den Columbia-Studios. Doch die Aufnahmen erscheinen nie, gewinnen mythische Züge. Stoff für eine hochspannende Unterhaltung mit Joyce Moreno – zumal diese Sessions nun endlich, nach 45 Jahren (Natureza, Far Out) veröffentlicht worden sind.
Am 10.1.2023 wird Joyce zu ihrem bevorstehenden 75. Geburtstag gewürdigt in der Jazz Collection von SRF 2 Kultur, wo ich ab 21h Gast beim Moderator Jodok Hess sein darf.
Wer 1977 auf der New Yorker East Street im total angesagten Disco-Schuppen „Hippopotamus“ tanzen ging, konnte gleiche nebenan einen neueröffneten Chill Out-Club namens „Cachaça“ entdecken. Stolperte man da rein, stand vielleicht gerade eine junge Brasilianerin auf der Bühne, flankiert von ein paar Landsleuten, zu denen der damals schon recht bekannte Perkussionist Naná Vasconcelos zählte. „Das war ein todschicker Club, und wir, ein Haufen wilder Youngsters, waren gleich für ein paar Monate gebucht“, erinnert sich Joyce Moreno, die damals freilich noch schlicht unter „Joyce“ firmierte. 1968 hatte sie mit ihrem Debütalbum in Rio das Zeitalter der Bossa Nova-Musen beendet, die nur das sangen, was ihnen die Männer auf den Leib schneiderten.
Ein Skandal, dass da plötzlich eine junge Frau aus weiblicher Perspektive selbst textete, und ihre Protesthaltung gegenüber dem Militärregime machte ihr das Leben als Musikerin nicht leichter. Jede Verpflichtung im Ausland kam da als Befreiung. In ihrer NY-Band trommelt João Palma, unter anderem Session-Mann von Frank Sinatra und Antônio Carlos Jobim – und als der die Songs hört, die Moreno im Jahr zuvor mit dem Sänger und Multiinstrumentalisten Maurício Maestro aufgenommen hatte, hat er einen Geistesblitz: „Das sollte unbedingt mal Claus hören.“ Claus? Will heißen: der Deutsche Claus Ogerman, jener legendäre, 2016 verstorbene Produzent, Arrangeur und Dirigent, der etliche Alben von Jobim mit dezenter, orchestraler Räumlichkeit veredelt hatte, darüber hinaus mit einer Starriege von Billie Holiday bis Bill Evans arbeitete.
Ogerman erwärmt sich sofort für das Material von Joyce Moreno und beraumt in den ehrwürdigen Columbia-Studios eine Session an. „Ich starb dafür mit Claus zu arbeiten, er war für mich eine Art Held!“, so Joyce. Kein Wunder, dass sie die Warnung ihres Freundes João Gilberto in den Wind schlägt. „Er war der Ansicht, Claus hätte sein gerade erschienenes Album ‚Amoroso‘ ruiniert, da die tiefen Frequenzen seiner Stimme nicht zu hören seien, er bezeichnete ihn gar als ‚Taugenichts‘. Aber so war João eben, ein schwieriger, aber lustiger Charakter. Ich denke, er war einfach eifersüchtig, dass Claus jetzt mit mir arbeiten wollte. Er schlug sogar vor, dass er selbst mein Album produzieren wolle. João Gilberto als Produzent, kannst du dir das vorstellen? Nie im Leben!“
Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. In der Band, die Joyce zu Columbia mitbringt, spielt neben Gitarrist und Co-Autor Maestro, Vasconcelos und Palma auch ihr zukünftiger Gatte, der Drummer Tutty Moreno, den sie gerade kennengelernt hat. Die Amerikaner Buster Williams (b) und Jeremy Steig (fl) werden hinzugebucht. Was dann passiert, ist recht überraschend: „Claus griff überhaupt nicht ein“, erzählt Joyce. „Er war super respektvoll gegenüber uns und gab uns völlige Freiheit. Der Beweis dafür ist die elfeinhalbminütige Version von ‚Feminina‘. Wir wussten im zweiten Teil, der Jam-Sektion nicht, wie wir zum Ende kommen sollten, und er ließ es einfach laufen. Was du heute hörst, ist das Ergebnis eines einzigen Takes, live, ohne Overdubs, so, wie ich bis heute gerne aufnehme.“ Genau wie beim Stück „Pega Leve“ verspricht er Joyce, das Resultat sei ja perfekt, er habe nichts mehr daran zu ändern. Doch Ogerman wäre nicht Ogerman, hätte er nicht noch hier wie in den anderen Stücken allerhand Zutaten eingebracht: Nachdem die Brasilianer das Studio geräumt haben, bestellt er Michael Brecker, Mike Manieri und Urbie Green für Tenorsax, Vibes und Posaune ein, ersetzt Steigs Flötensoli durch Joe Farrell, und er textiert in einigen Tracks dann mit dem für ihn so typisch pastellfarbenen Streichorchester.
Nicht bei all diesen Eingriffen wird Joyce um ihr Einverständnis gefragt. Sie ist aus familiären Gründen mittlerweile nach Rio zurückgekehrt, bleibt mit Ogerman aber in Verbindung. Der aber will vor einer Veröffentlichung weitere Veränderungen durchsetzen. Zwei der sieben Stücken stammen aus der Feder von Maurício Maestro, melancholische Balladen im Stil der Clube da Esquina-Bewegung um Milton Nascimento. Joyce soll Maestros Leadgesang ersetzen. Und überhaupt: alle Gesangsspuren noch einmal neu auf Englisch einsingen. Eine rote Linie. „Er schlug mir als Übersetzer Michael Franks vor“, erklärt Joyce. „Aber was wäre von meinen Texten dann noch übriggeblieben? In ‚Feminina‘ geht es schließlich um den Dialog von Tochter und Mutter, die sich darüber unterhalten, was ‚Weiblichkeit‘ heißt. Ein Mann hätte das Thema völlig verändert.“ Und dann verweist sie darauf, was ihrem guten Freund Jobim passierte, der seine Bossa-Hits von Ray Gilbert und Norman Gimbel anglisieren ließ. „Auf eine Art war Jobim klüger, denn so konnte seine Musik um die ganze Welt reisen. Aber irgendwann sagte er zu mir: ‚Hätte ich das Geld, würde ich ‚The Girl From Ipanema‘ zurückkaufen.‘ Denn Gimbel, ein Typ, der übrigens nie in Ipanema war, verdiente vielmehr dran als der Urheber selbst.“
Als unüberbrückbar erweisen sich die Differenzen zwischen Ogerman und Moreno, die Sessions bleiben in der Schublade. Doch die Prima Materia aus NY, großartige Kompositionen wie „Feminina“, „Misterios“ oder „Moreno“, nimmt Joyce Anfang der Achtziger in Rio neu auf, sie begründen ihren Ruhm bei der Rare Groove-Gemeinde der 1990er. Unterdessen gelingt es selbst Verve, wo Moreno später unter Vertrag steht, nicht, einen Deal mit Ogerman hinzubekommen, der irrsinnige Summen für eine Veröffentlichung verlangt. Nur Christian Kellersmann von Universal kann sich die Rechte zweier Songs (das hymnische, im 7/4-Takt kreisende „Descompassadamente“ und „Feminina“) für die Kompilationen The Man And The Music und Trip To Brazil sichern.
„Dass diese Aufnahmen jemals komplett rauskommen, daran habe ich große Zweifel!“, sagte Joyce noch 2005, als wir sie für die Jazz thing-Homestory besuchten. Jetzt, siebzehn Jahre später, kann sie auf dem gleichen Sofa sitzend den Release verkünden. „Es ist der Beharrlichkeit von Joe Davis meines englischen Labels Far Out zu verdanken. Joe hat immer dafür gekämpft.“ Unter idealen Umständen erblicken die Natureza-Sessions das Licht der Öffentlichkeit nicht. Far Out hat die Musik von einem Cassetten-Mitschnitt runtergezogen, der in Morenos Besitz war, eine Feinabmischung war unmöglich, wohl aber ein Remastering mit den Optionen des Jahres 2022. Das reicht, um beim Anhören eine Frische und Lebendigkeit rüberzubringen, bei der man das Fehlen einer klaren Spurentrennung gerne in Kauf nimmt. Welche Alternativen ihrer Songs gefallen nun Joyce selbst besser? Ihre Antwort ist diplomatisch: „Die Versionen aus Rio klingen klarer, keine Frage. Aber die New Yorker Aufnahmen fangen einen ganz besonderen Moment in meiner Karriere ein.“ Der Mythos, er wurde endlich zum zweiten Leben erweckt.
© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing #146
am 10.1.2023 wird Joyce zu ihrem bevorstehenden 75. Geburtstag von mir gewürdigt in der Jazz Collection von SRF 2 Kultur, wo ich ab 21h Gast beim Moderator Jodok Hess sein darf.

 Milton Nascimento
Milton Nascimento