 Eine der großen Ladies des Florida Soul ist gegangen – Betty Wright, die in den 1970ern mit hartkantigem Funksound, aber auch mit tiefen Balladen zu einer der führenden Stimmen im Soul wurde, starb im Alter von 66 Jahren. Mit einem epischen Stück im Schmachtgewand möchte ich sie hier würdigen.
Eine der großen Ladies des Florida Soul ist gegangen – Betty Wright, die in den 1970ern mit hartkantigem Funksound, aber auch mit tiefen Balladen zu einer der führenden Stimmen im Soul wurde, starb im Alter von 66 Jahren. Mit einem epischen Stück im Schmachtgewand möchte ich sie hier würdigen.
Monat: Mai 2020
Die Zukunft war gestern
 Ein schlimmer Tag für alle SciFi-Nostalgiker und wahren Techno-Geister: Florian Schneider-Esleben, das kreative Mastermind von Kraftwerk neben Ralf Hütter, ist gestorben. Aus diesem Anlass möchte ich hier nochmals meine beiden Live-Begegnungen mit Kraftwerk teilen – auch wenn Schneider da nicht mehr dabei war, hatte er doch alles, was, Kraftwerk nach seinem Ausstieg gemacht hat, mitgeprägt.
Ein schlimmer Tag für alle SciFi-Nostalgiker und wahren Techno-Geister: Florian Schneider-Esleben, das kreative Mastermind von Kraftwerk neben Ralf Hütter, ist gestorben. Aus diesem Anlass möchte ich hier nochmals meine beiden Live-Begegnungen mit Kraftwerk teilen – auch wenn Schneider da nicht mehr dabei war, hatte er doch alles, was, Kraftwerk nach seinem Ausstieg gemacht hat, mitgeprägt.
Kunstsammlung Düsseldorf
16.+ 17.01.2013
Die Zukunft hatte ihre Chance. Doch irgendwie hat sie ihren Einsatz verpatzt. Wir Kinder der Siebziger träumten vom Beamen, Zeitreisen und Städten auf dem Mars. Verknüpft war das alles mit dem magischen Datum 2000, und die Musik dazu lieferte eine Band namens Kraftwerk. „Wir sind die Robotärrr“, sangen wir, und sahen uns im neuen Millennium als Helden in einem Science Fiction-Szenario. Pech gehabt: 2000 ist gerade Teenie geworden und schlägt sich ganz uncool mit Klimakollaps, Eurokrise und Shitstorms herum. Fast unheimlich, dass die Musik von Kraftwerk noch immer gefeiert wird. Und das, wo ihre prophetischen Themen durch den Alltag banalisiert sind (Internetliebe, Computerüberwachung), andere Titelhelden ihrer Songs ausrangiert (Trans Europa-Express), des Dopings überführt (Tour de France) oder als Massenkiller entlarvt (Radioaktivität). Was ist also das Geheimnis ihrer trotzigen Zeitlosigkeit? Es lässt sich derzeit direkt an ihrer Heimstatt ergründen, das erste Mal seit 22 Jahren. Auf dem Weg zum Kulturerbe präsentieren Kraftwerk in der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW, wie wenige Monate zuvor im New Yorker MoMA, ihren gesamten, 2009 remastered veröffentlichten Katalog von „Autobahn“ bis „Tour de France“, mit den schon erprobten 3D-Animationen, doch zum allerersten Mal in Surroundsound.
Eingefunden hat sich überwiegend eine Männerwelt 40+ an diesem Abend, der dem Album „Menschmaschine“ gewidmet ist. Hier und da stechen Grüppchen im Dresscode des Covers (schwarze Hose und Krawatte, rotes Hemd) heraus. Sie tragen ernste, würdevolle Mienen zur Schau. Ein paar junge, lautstarke Briten trinken Altbier – das gesamte Konzert hindurch werden sie raumgreifend raven, jede Synthmelodie mitsingen, angeregt plaudern. Für die meisten anderen beginnt mit der Ansage via Roboterstimme ein Gottesdienst. Sie erstarren in Ehrfurcht wie die Schaufensterpuppen aus dem Song ihrer Idole.
Dabei menschelt es in dieser Maschine gleich zu Beginn ein wenig. Im hymnischen Titeltrack hinkt Ralf Hütter, einziger aus der Kernbesetzung Verbliebener, mit seinem Live-Vocoder dem Beat hinterher. Eine Randnotiz in der grandiosen Reizflut: Geometrische Körper stechen in den Zuschauerraum, eine Raumstation segelt dicht am Kopf vorbei und gemeinsam mit dem Elektroquartett taucht man zwischen graue Wolkenkratzerschluchten. Am Sound ihres Meilensteins haben Kraftwerk sachte aber wirksam die Stellschrauben gedreht: „Metropolis“ gleitet in einen härteren 80er-Groove, „Das Model“ ist deutlich fetter textiert und erhält von Hütter staccatohafte Vocals. Erst als Finale kommt das Roboterlied – mit organischer Tempogestaltung, mit peitschenden Techno-Improvisationen, mit kristallklarer Fraktierung der Maschinengeräusche auf die 24 Boxen. Auch die Best Of-Zeitreise im zweiten Set profitiert von den räumlicheren Nuancen:
Der „TEE“ rauscht und seufzt mit mehr Industrialcharakter durch den Saal, splitterndes Glas bei den Schaufensterpuppen durchdringt jeden Quadratmeter. “Radioaktivität“, nach Fukushima zum Fanal gegen Nuklearenergie umgetextet, steigert sich housig, während beklemmend die Geigerzähler um die Ohren fiepen. Doch bei aller digitaler Aufstockung, bei allem Raumklang: die Grundsubstanz der Songs wirkt weiterhin wie eine Urtinktur. Da geht viel auf das Konto der emblematischen Melodien, die – Myriaden von Coverversionen beweisen es – auch jenseits der Elektrosphäre funktionieren. Die höchste Konzentration an Bad aus Klang und Bild dann im „Planet der Visionen“, der auch für die Technogeneration noch Maßstäbe setzt. Hier ist sogar die heute schon staksig wirkende Robotik aufgelöst, als elastische Gitternetzmännchen agieren die Musiker in der Animation.
Große Eingriffe ins Drehbuch dann am Folgeabend mit der „Computerwelt“: Hier verschmelzen die einzelnen Tracks zu einer leitmotivischen Suite, während ein grandioses Farbenspiel aus Zahlen, Hüllkurven und Strichcodes im Raum oszilliert. Psychedelia ist in der Pixelwelt angekommen. Im „Taschenrechner“ improvisiert Hütter mit Spaß über „das kleine Musikstück“, das der Musikant im Text spielt. Überhaupt wirken die Düsseldorfer Gigs fast handwerklich: Hinter ihren unergründlichen Audioaltären drehen, schieben und „zeichnen“ die Musiker, wippen und grooven, konträr zu der Starre von einst. Beim Abgang spielt ein jeder tatsächlich sein Solo, tritt aus dem Kollektiv heraus: Fritz Hilpert, der Beatgeber, Henning Schmitz, der Tieftöner, Falk Grieffenhagen, der Videomann und der Melodiker Ralf Hütter.
Eine „industrielle Volksmusik“ wolle er kreieren, hat Hütter einmal gesagt, aus dem Nichts der verlorenen kulturellen Identität der Nachkriegsgeneration. Die tanzenden Briten im Saal haben Kraftwerks Lieder auf ihre Art schon als neue German Folk-Attraktion angenommen. Für die Deutschen selbst, so schien es in Düsseldorf, bleiben sie auch nach Jahrzehnten etwas Mythisch-Romantisches. Doch genau in dieser Sphäre siedelt Volksmusik hierzulande ja. Wer in Hütters Gesicht schaute an diesen Abenden, sah nicht den Technokraten, sondern entdeckte auch den Empfindsamen. Im 21. Jahrhundert ist der eben im urbanen Raum anzutreffen, schwärmt mit milder Kopfstimme übers „Neonlicht“, wärmt sich an den oftmals geradezu femininen Timbres der Synthesizer. Konsequenter als alle ihre elektronischen Nacheiferer hegen Kraftwerk an der Kreuzung von Utopie und Nostalgie die Poesie, haben die zwei zentralen Stränge der deutschen Seele, Präzision und Romantik verschmolzen. Genau das macht sie zeitlos, auch wenn die Zukunft eigentlich schon vorbei ist.
© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, 18.01.2013
ZKM Karlsruhe
13.09.2014
Romantiker in gekacheltem Neopren
Als die vier Herren Anfang letzten Jahres in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf ihren „Katalog“ spielten, habe ich eine These entwickelt. Eigentlich sind die Techno-Urväter empfindsame Poeten und verkörpern die beiden Antipoden der deutschen Seele: Präzision und Romantik. Das ZKM in Karlsruhe feierte jetzt 25-jähriges Bestehen und lud Kraftwerk zum Jubiläum. Gelegenheit also, diese These nochmals zu überprüfen.
Es ist mehr Feuer in der vollen Hütte als vor 20 Monaten. Die Karlsruher scheinen besser feiern zu können, was mich wundert. Oder wollte in Düsseldorf niemand – außer den englischen Gästen – tanzen, da man direkt am Headquarter der Elektro-Urgesteine in Vergötterungs-Stase verharrt? Hier jedenfalls headbangt so mancher, auch sind ein paar mehr Frauen da, ein paar haben sich sogar ins schwarz-rote Mensch-Maschinen-Dress geworfen, samt peinlich blinkendem Schlips. Und das Tanzen bringt auch lustige Effekte mit sich: Die 3D-Projektionen schaukeln dann nämlich mit, bei „Computerwelt“ wippt plötzlich der VC 64 vor meiner Nase im Takt. Vorweggenommen sei das schönste Geschenk an die Karlsruher: Nachdem sich das „Spacelab“ ein paar Mal mit seinen Antennen in die Köpfe des Publikums gebohrt hat, landet es im Innenhof des ZKM. Man ist entzückt.
Mensch-Maschine und Computerwelt, die beiden stärksten Säulen im Kraftwerk-Katalog, bestreiten die ganze erste Hälfte des Abends. Gleich zu Beginn wird mit den „Robotern“ viel Pulver verschossen, sie sind ein bisschen discomäßig auffrisiert. Die „Nummern“, technoide Blaupause par excellence, wummern weitaus mehr als in DüDo, dazu oszillierende Zahlenhaufen auf Berg- und Talfahrten: Sie atmen. Meine Härchen auf den Unterarmen stellen sich auf. Ich bin ein kybernetisches Wesen. Und es saugt mich bei „It’s More Fun To Compute“ und „Heimcomputer“ mit einer gegurgelten Impro-Passage noch mehr in diese vieldimensionalen Reize, in dieses abstrakte Innenleben der Daten-“Autobahn“.
Doch ich bin ja auf der Suche nach dem Romantischen in Kraftwerks Musik. Ralf Hütters Stimme ist in jedem Fall der Humanizer-Faktor in diesem Apparat, das war sie schon immer. Er kann ja eigentlich nicht singen, sein Organ klingt wie das eines etwas hilflosen Diseurs, der in einer Herrentoilette übt. Und wenn er singt, hat er gelegentlich diesen verklärten Blick auf seinen Keyboard-Altar, oder er schließt gar die Augen. Ja, er ist ein Sensibler, im „Neonlicht“ wird er gar schwärmerisch-melancholisch. Das geht aber auch nur, weil die Leuchtreklame so retro ist und man der Werbung für 4711 oder Klosterfrau Melissengeist wirklich nachtrauern kann. Ja, dieses glimmende Neonlicht der Fünfziger bis Siebziger, es bietet dem Eichendorff des 21. Jahrhunderts Heimstatt, damit er statt im mondbeschienenen Wald nun in den lodernden Häuserschluchten umherwandert.
Dann geht es endlich zurück und vor in der Chronologie der Band. Mir fällt auf, dass „Autobahn“ mit einer strahlenden F-Dur-Akkordbrechung beginnt, fast ein wenig wie das C-Dur der Rheingold-Ouvertüre. Aber dem F wird seit Schubert die Farbe der Natur zugeordnet, und in der Kli-Kla-Klawitterbus-Animation zum Track wird das silberne Band von sehr, sehr vielen grünen Hügeln bekränzt.
Datenbahn – Autobahn – Eisenbahn: Kraftwerk lieben die vorgegebene Spur. Ausgerechnet bei meinem Lieblingsstück, dem „Trans-Europ-Express“, versagt anfangs die Projektion. Ich mag es, wenn es in der Maschine menschelt. Doch schließlich gleitet der TEE fahrplanmäßig über die nächtlichen Stränge – wenn das keine Eisenbahnromantik ist. Ich finde, der SWR sollte seine spießige Sesselpupser-Serie mit diesem Track ausstatten.
Es folgt dann leider ein überlanger Tour de France-Block. Der cyclophile Ralf Hütter, der im rigiden gekachelten Neopren-Anzug immer noch ziemlich durchtrainiert aussieht, verklärt dieses Rennen mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf der Leinwand, mit der heutigen gedopten Form der großen Schleife lässt sich kein Staat machen. Nicht verklärt dagegen wird die „Radioaktivität“, sie ist längst mit Strahlentod und Fukushima-Warnungen versehen worden. Man muss davon ausgehen, dass Kraftwerk früher fortschrittsgläubig waren, heute widerfährt einigen ihrer „besungenen“ Objekte eine kritisch hinterfragte Betrachtung. Verzwirbelt mit einer glücklich gewählten Portion Nostalgie.
Wir gucken uns ihre Konzerte deshalb noch so gerne an, weil sie eben diese Faszination der vergangenen Zukunft bergen, die so nicht eingetroffen ist – so wie wir auch gerne in Ostblock-Verfilmungen von Lem-Romanen schwelgen oder das Raumschiff Orion Kult finden. Dieser warme, behagliche Futurismus, den die kalte, digitale Realität überholt hat, den gibt’s im Leben nicht mehr. Selbst als sie am Ende in ihrem futuristischsten Stück, dem „Planet der Visionen“, sich als 3D-Strichmännchen auf dem Holodeck doppeln, sieht das für den Menschen des Jahres 2014 nicht mehr wirklich nach SciFi aus, und die Synth-Timbres sind immer noch sehr heimelig, klingen fast nach einem Chor. Wirklich Zukunft, das schaffen Kraftwerk nicht. Sie sind tatsächlich Romantiker einer verlorenen Zeit, und dabei ungeheuer präzise, sehr germanisch eben. Nach der zweiten Zugabe schaut Hütter lange auf seine Uhr und sagt: „Das waren jetzt zwei Stunden.“ Er lässt die Kelle fallen, ganz der akkurate Handwerker. Aber dazu lächelt er milde.
© Stefan Franzen
Saint Quarantine #13: Trost aus Hamburg
 Heute im Zürcher Bogen F, übermorgen im Karlsruher Jubez: Das wäre der Tourplan für den großartigen Niels Frevert in unserer Region gewesen, zwei Konzerte, auf die ich mich wie ein Schneekönig gefreut habe. Die Zeiten sind nun leider anders und wir können nur auf die kommenden Monate hoffen. Dass das Virus nicht zurückkehrt, dass die Politik die Kultur als systemtragend begreift, dass sie beweist: Deutschland ist nicht nur eine Lufthansa- und Volkswagen-Nation, sondern auch eine, die besondere Dichter wie diesen Mann aus Hamburg hervorbringt. Bis dahin, und darüber hinaus gilt: Es gibt immer noch die Musik.
Heute im Zürcher Bogen F, übermorgen im Karlsruher Jubez: Das wäre der Tourplan für den großartigen Niels Frevert in unserer Region gewesen, zwei Konzerte, auf die ich mich wie ein Schneekönig gefreut habe. Die Zeiten sind nun leider anders und wir können nur auf die kommenden Monate hoffen. Dass das Virus nicht zurückkehrt, dass die Politik die Kultur als systemtragend begreift, dass sie beweist: Deutschland ist nicht nur eine Lufthansa- und Volkswagen-Nation, sondern auch eine, die besondere Dichter wie diesen Mann aus Hamburg hervorbringt. Bis dahin, und darüber hinaus gilt: Es gibt immer noch die Musik.
Niels Frevert: „Immer noch die Musik“
Quelle: youtube
Balancekünstler der Worte: Zum Tod von Aldir Blanc
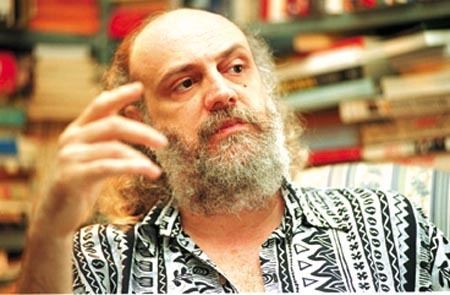
Wenn ein Blog fast täglich zum Sterbeportal wird, sind die Zeiten schwer.
In Brasilien hat Covid-19 nun meinen geschätzten und geliebten Songschreiber Aldir Blanc erwischt, der heute im Alter von 73 Jahren in Rio verstorben ist. Aldir Blanc (sprich: „blanki“) wurde vor allem als kongenialer Texter für João Bosco, den Star der Música Popular Brasileira (MPB) bekannt, mit dem er in den 1970ern geniale Alben wie Caça A Raposa oder Galos De Briga austüftelte. Eine weitere starke Songschreibe-Partnerschaft unterhielt der Poet mit Ivan Lins und dem Gitarristen Guinga. Seine Lieder wurden von vielen MPB-Künstlern aufgegriffen, am bekanntesten wurde sein Samba „O Bêbado E A Equilibrista“ (der Betrunkene und die Seiltänzerin) in der unsterblichen Version von Elis Regina, ein metaphernreiches Wunderwerk, das die Seelennöte der Menschen während der Militärdiktatur beschrieb.
Ich möchte den großen Aldir Blanc mit einem etwas unbekannteren Canção namens „O Cavaleiro E Os Moinhos“ würdigen, der in meiner Übersetzung natürlich nur einen kleinen armseligen Eindruck von seiner poetischen Strahlkraft gibt: „Der Glaube daran: Es gibt eine goldene Existenz der Sonne, auch wenn uns ununterbrochen die Peitsche der Nacht auf den Mund schlägt. Aufbrechen, zur Strömung, die den Morgen mit sich bringt, die Schwerter aufwecken, die Sphingen der Kreuzwege hinwegfegen. Es war die ganze Zeit, als ob man auf einem Schiff schliefe: ohne sich zu bewegen, aber den Faden aus Wasser und Wind weben. Ich, Unruhestifter, ich wurde unterwegs ein Ritter, schelmisch. Mein Begleiter ist bis an die Zähne bewaffnet: Es gibt keine Mühlen mehr wie früher.“
João Bosco: „O Cavaleiro E Os Moinhos“
Quelle: youtube
Der Architekt des Afrobeats: Tony Allen ist gegangen

Tony Allen in Essaouira, Marokko, Mai 2015 (Foto: Stefan Franzen)
Mit großer Bestürzung hat die Musikwelt den plötzlichen Tod der Schlagzeuglegende Tony Allen aufgenommen. Der 79-Jährige starb am gestrigen Donnerstag völlig unerwartet in seiner Wahlheimat Paris, kurz nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, weil er sich unwohl fühlte. Sein Tod steht offenbar nicht im Zusammenhang mit Covid-19.
Heute ist der Begriff „Afrobeat“ weltweit in aller Munde, sein Architekt war Tony Allen. 1940 im nigerianischen Lagos geboren, formte er die afrikanische Popmusik seit den Sechzigern entscheidend mit. „Ich wollte der beste Drummer Nigerias werden, hatte aber anfangs keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen sollte“, erinnerte er sich in seiner Wahlheimat Paris während eines Interviews mit dem Autor. „Da geriet mir die Jazz-Zeitschrift Down Beat in die Hände, mit einer Lektion von meinem amerikanischen Kollegen Max Roach. Seine Anweisungen kombinierte ich mit allem, was ich vorher in Nigeria gelernt hatte – und plötzlich spielte ich wie niemand anders.“ Ein weiteres Idol wird Art Blakey.
Erstmals wandte Allen seine Spielweise bei der Combo Cool Cats von Victor Olaiya an. Aufmerksam auf seine rhythmischen Künste wurde 1964 ein weiterer Landsmann: Fela Kuti, charismatischer Bandleader, gerade auf der Suche nach einem Drummer für seine Koola Lobitos: „Er sagte, ich würde wie vier Schlagzeuger gleichzeitig spielen“, erinnerte sich Allen. Tatsächlich rätseln Drummer bis heute über das synkopische, polyrhythmische Hexenwerk, das Allen mit verblüffend ökonomischer Spielweise zauberte. Er verschmolz mit seinem Drumkit, liebkoste die Felle aus dem Handgelenk, bediente das Bassdrum-Pedal kernig und zärtlich zugleich. Dabei glich er einem passioniert rührenden Koch am heimischen Herd, und tatsächlich hieß später denn auch eines seiner zentralen Werke Home Cooking.
Tony Allen teaches Tim Jonze
Quelle: youtube
Gemeinsam entwickelten Allen und Kuti 1968/69 aus dem in Westafrika populären Highlife, Yoruba-Traditionen und Jazz-Einflüssen einen neuen Stil, den Fela auch politisch auflud: Hypnotische Grooves und Antwortchöre mit provokanten Texten an die Adresse der korrupten Machthaber – diese manchmal 30 Minuten langen Stücke werden prägend für die neue Band Africa 70. Immer wieder ist die Parallele gezogen worden zwischen Afrobeat und dem Funk von James Brown.
Allen stellte in meinem Interview für Jazz thing 2008 klar: „Ich würde nie sagen, Funk habe aktiv den Afrobeat beeinflusst, auch nicht die Gegenrichtung. Das passierte allenfalls unterschwellig. Aber es war tatsächlich so, dass Brown mit seiner ganzen Band nach Lagos kam und seinen Arrangeur als Spion neben mich setzte. Der sollte genau aufschreiben, was ich da spiele. Ich dachte mir damals: ‚OK, in aller Ruhe warte ich jetzt mal ab, ob irgendjemand mich imitieren kann.’ Ich warte bis heute!“
Nachdem Allen 30 Platten mit Kutis Afrobeat-Orchester eingespielt hat, gingen die beiden Ende der 1970er getrennte Wege. Die Allüren seines Chefs, die riesige Entourage von Africa 70 – das war nicht die Welt des bescheidenen Mannes mit der schnarrenden Stimme. Bei Africa 70 war er auch meist ganz im Hintergrund gestanden, signfikant, dass er in diesem Live-Video aus dem Jahre 1978 überhaupt nicht ins Bild kommt:
Fela Kuti: Pansa Pansa (Berlin 1978)
Quelle: youtube
Allen nahm zunächst nur ein paar wenige Alben unter eigenem Namen auf, No Accommodation For Lagos das wichtigste unter ihnen. In der Wahlheimat Paris musste er lange Durststrecken durchstehen, bis ihn zur Jahrtausendwende eine neue Generation wiederentdeckte. Dafür verantwortlich war zunächst der Elektro-Produzent Doctor L, der mit ihm psychedelisch eingefärbte Werke wie Black Voices einspielte, auch der finnische Musiker Jimi Tenor entdeckte den Nigerianer. Ab diesem Zeitpunkt ging Allen unzählige Teamworks ein. Man konnte ihn in Marokko beim Gnawa-Festival von Essaouira mit Sufis auf der Bühne sehen, als Rhythmusgeber für eine haitianische Bigband, und in Damon Albarns afro-europäischem Trupp „Africa Express“ wurde er Stammgast. Fast ein Dutzend Scheiben veröffentlichte er während seines zweiten Frühlings, unter ihnen das grandiose Alterswerk The Source, entstanden 2017 mit Musikern, die alle einer anderen Generation als er selbst angehören.
Tony Allen: „The Source“ (Teaser)
Quelle: youtube
Und vor wenigen Wochen erschien noch Rejoice, eine Session, die mit dem 2018 verstorbenen südafrikanischen Flügelhornisten Hugh Masekela von World Circuit-Produzent Nick Gold eingefangen worden war und nun zum doppelten Vermächtnis wird. Parallel dazu war es ihm immer ein Anliegen, wie etwa auf Secret Agent (2008), junge nigerianische Musiker zu fördern. Tony Allen konnte sich im Alter darüber freuen, dass der Afrobeat zu einer globalen Angelegenheit wurde. Bands in Brooklyn und Toronto aber auch in Berlin, Stockholm und Tel Aviv haben Allens und Fela Kutis Errungenschaften adaptiert. „Ich sehe, wie der Baum, den ich mal gepflanzt habe, viele Zweige bekommen hat“, sagte er mit einem milden Schmunzeln.
Einige meiner Erinnerungen an ihn sind besonders: Erstmals traf ich Tony nahe der Porte de Clignancourt im Norden von Paris zu einem eindrucksvollen Interview im Séparée eines arabischen Teehauses, wo er nach dem langen Gespräch noch die Geduld hatte, mir unzählige LPs zu signieren. 2013 sah ich ihn völlig unvorbereitet, wie er während eines Konzerts der New Yorker Afrobeat-Band Antibalas für einen Gastauftritt bei Jazz à La Vilette auf die Bühne kam, und der Antibalas-Drummer Miles Arntzen ehrfürchtig in die zweite Reihe zurück trat. Zwei Jahre später erklärte er uns Journalisten im marokkanischen Essaouira, mit seiner sanften Stimme kaum über die parallelen Muezzin-Rufe hinwegdringend, wie sich die Afrobeat-Rhythmik mit der der Gnawas wunderbar vereinbaren lässt, und lieferte dann mit dem Gnawa-Meister Mohammed Koyou aus Marrakesch eine relaxte Mitternachtssession zur hereinrollenden Gischt des Atlantiks ab.
Zuletzt habe ich Tony exakt vor einem halben Jahr beim Jazz No Jazz-Festival in Zürich gesehen: Ich bin vorsichtig mit dem überstrapazierten Wort „Trance“, aber was an Allerheiligen 2019 mit der jungen „The Source“-Band entstand, versetzte mich in einen Zustand, der nicht mehr ganz diesseitig war. „Ihr seid ja nicht hier, um mich reden zu hören“, entschuldigte sich Tony Allen an jenem Abend für seine knappen Ansagen. Ein Mann der großen Worte war er nicht, wohl aber des großen Spiels. Mit Tony Allen verlieren wir einen unvergleichlichen Polyrhythmiker, der hohes technisches Können, unermüdlichen Einsatz für seine Musik und eine anrührende Menschlichkeit in sich vereinte.
© Stefan Franzen

