 Fleet Foxes
Fleet Foxes
Shore
(Anti/Indigo)
Es war ein hübscher Coup, mit dem die Seattler Folkrockband ihr viertes Album veröffentlichte: Pünktlich zur Tagundnachtgleiche am 22. September streamten sie “Shore”, ihr Album zur Pandemie, die Bandleader Robin Pecknold mit dem Rückzug in seine Küche, Plätzchenbacken und die gelegentliche Teilnahme an Black Lives Matter-Demos bewältigte. Und natürlich mit Songschreiben. Paradoxerweise öffnete Corona dem zu nagenden Selbstzweifeln neigenden Pop-Poeten neue musikalische Türen. Denn mehr als alle Fleet Foxes-Alben zuvor, allen voran dem düster-mythischen Vorgänger “Crack-Up”, verströmt “Shore” den lichten Charme des Optimismus.
Die fünfzehn Songs fließen oft in majestätischen Dur-Tonarten: „Jara“ erinnert an die strahlenden, verhallten Hymnen der Byrds, „Featherweight“ kleidet sich mit leicht verstimmten Schrammelgitarren als verträumter Schlafzimmer-Folk ein, „Quiet Air“ schichtet Pecknolds Stimme zu einem fast sakralen Chor. Mit „Maestranza“ besitzt das Album eine muskulös trabende Rocknummer, mit „Cradling Mother…“ eine strahlende Apotheose, in der sich der ohnehin voluminöse Bandsound zu Blechbläsern weitet. Und trotz der mächtigen Sounds bleibt „Shore“ intim und empfindsam mit Widmungen an zu früh gegangene Musikerkollegen und an die Laute der Natur, die zwischen den Songs aufscheinen. Ein großer, Weite atmender pazifischer Trip, begleitet durch einen Film von Kersti Jan Werdal mit Bildern von der US-Westküste.
© Stefan Franzen


 Yumi Ito, Foto: Maria Jarzyna
Yumi Ito, Foto: Maria Jarzyna Foto: Albert Josef Schmidt
Foto: Albert Josef Schmidt Foto: Albert Josef Schmidt
Foto: Albert Josef Schmidt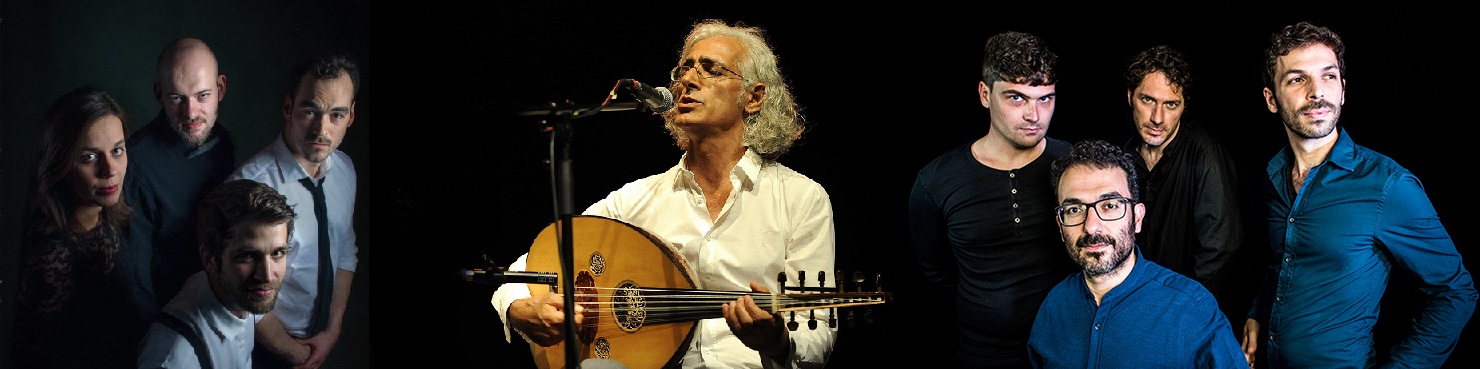


 Foto: Mayada Wadnomiry
Foto: Mayada Wadnomiry Foto: Alexandra Heneka
Foto: Alexandra Heneka Foto: Alexandra Heneka
Foto: Alexandra Heneka Foto: Alexandra Heneka
Foto: Alexandra Heneka Foto: Mayada Wadnomiry
Foto: Mayada Wadnomiry Foto: Stefan Franzen
Foto: Stefan Franzen Foto: Mayada Wadnomiry
Foto: Mayada Wadnomiry Foto: Alexandra Heneka
Foto: Alexandra Heneka Foto: Alexandra Heneka
Foto: Alexandra Heneka Foto: Stefan Franzen
Foto: Stefan Franzen Foto: Jens-Taro Herbel
Foto: Jens-Taro Herbel Foto: Stefan Franzen
Foto: Stefan Franzen Foto: Jens-Taro Herbel
Foto: Jens-Taro Herbel