
Aus aktuellem Anlass schalte ich nochmals den Artikel über Simin Tander hoch:
Simin wird zweimal im Süden Deutschlands mit ihrem neuen Quartett gastieren und das neue Album The Wind spielen:
19.10. Jazzhaus Freiburg
20.10. Karlstorbahnhof Heidelberg (Enjoy Jazz Festival)
Mit multinationalem Team hat die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander ihr fünftes Album The Wind (Jazzland Recordings/edel Kultur) eingespielt. Wie der Namensgeber fließt es grenzenlos zwischen Indien, Afghanistan, Europa und Amerika.
Es passiert etwa in der Mitte ihres neuen Werks: Für die stürmische Jagd einer Wolke über den Himmel greift Simin Tander zum Sprechgesang, rappt fast die Poesie des englischen Romantikers Percy Bysshe Shelley. „Diese Dramatik mit den archaischen Bildern von Natur und Donner, das hat mich berührt, weil es so klar ist und eine unglaubliche Kraft hat“, sagt sie. „Nursling Of The Sky“ ist zugleich ein Schaukasten dafür, was mit ihrer erprobten Rhythmusgruppe möglich ist: Die funky groovenden Kletterlinien des schwedischen Bassisten Björn Meyer und die tribal galoppierende Kraft des Schlagwerkers Samuel Rohrer vereinigen sich hier zu elektrisierender Energie. Die hat so gar nichts Romantisches mehr an sich und konnte „nur mit diesen beiden, die eine starke individuelle musikalische Sprache auf ihrem Instrument entwickelt haben“ gezündet werden. Mit beiden hatte die Deutsch-Afghanin schon auf dem Vorgänger „Unfading“ gearbeitet. Komplettiert wurde das Quartett damals durch die Viola d’Amore des Tunesiers Jasser Haj Youssef, was insgesamt zu einem eher gedeckteren Klangspektrum führte – ihr damaliger Ausdruckswunsch mit einer Stimme, die sich schwangerschaftsbedingt tiefer gefärbt hatte.
Jetzt ist aber Harpreet Bansal neue Partnerin im Quartettgefüge: Die indische Geigerin, geschult im Raga-System, sorgt für helleres Kolorit: „Ihr Ton ist sehr warm und voller als das, was man von einer Geige normalerweise kennt, aber sie hat auch dieses endlos in die Höhe steigende. Und sie ist eine Meisterin darin, meinem Gesang zu folgen. Bei manchen Stücken ist sie wie ein verschnörkelter Schatten der Melodie, bei anderen spielt sie bewusst nur in die Pausen der Gesangsmelodie. Die Herausforderung war, dass ich auf meinem Pfad bleibe, obwohl da eine weitere ‚Stimme‘ ungefähr den gleichen Weg direkt hinter mir geht. Nur so ist das Gesamte wirklich stark.“ Man kann dieses faszinierende Miteinander von Bansal und Tander tatsächlich als Tanz einer Persönlichkeit wahrnehmen, die sich in verschiedene Nuancen auffächert. Gewissermaßen als „Windspiel“ gleitenden und suchenden Charakters.
Das Album „The Wind“ beherbergt denn auch die verschiedensten Ausprägungen, die die Bewegung der Luft haben kann, vom Säuseln und Hauchen bis zur ekstatischen Entladung. Verblüffend, wie das Quartett eine Synthese zwischen packender Körperlichkeit und der Sphäre des Ungreifbaren in Töne gefasst hat. „Ich scheine eine Vorliebe für die Elemente zu haben“, schmunzelt Tander, die in ihrem neuen Werk Bezüge an die Wasser-Hommage „Where Water Travels Home“ von 2013 entdeckt. „Der Wind hat für mich eine symbolische Bedeutung für etwas, das durch die verschiedenen Epochen und Sprachen zieht und alles miteinander verbindet.“ Das wird durch das denkbar breite Repertoire auf dem Werk belegt. Als Gegenpol zur virilen Shelley-Vertonung wirft Tander die Hörenden mitten hinein in die Ära des neapolitanischen Liedes mit „I‘te Vurria Vasà“ von Edoardo Di Capua („O Sole Mio“), befreit es aber von allem opernhaften Schmelz und Pathos, nur mit begleitendem Geigenhauch. Eine Bearbeitung eines norwegischen Kirchenliedes und ein spanisches Lullaby schaffen weitere Klangräume aus europäischen „Randzonen“. Der inspirative Geist des Windes, er lässt sich von keiner Grenze stoppen.
Simin Tander – „The Wind“ Album Trailer
Quelle: youtube
Linguistische Challenges sind fester Bestandteil in Tanders Repertoire-Auswahl. Schon vor zwölf Jahren setzte sie sich das ehrgeizige Ziel, im komplexen Paschtu zu singen. Näherte sich der Sprache ihres Vaters, indem sie eines seiner Gedichte vertonte, phonetischen Unterricht bei einem Freund der Familie nahm, der ihr auch viele Lieder der Region erschloss. Seitdem ist das paschtunische Idiom fester Bestandteil ihrer Alben geworden. Populäre Songs der Region, die oft aus Bollywood-artigen Streifen stammen, finden sich auf „The Wind“ gleich dreifach und haben eine erstaunliche Metamorphose hinter sich. „Meena“ eröffnet das Album mit einem Gedicht aus dem 18. Jahrhundert, das Tander durch die populäre Sängerin Qamar Gula kennengelernt hatte. An „Jongarra“ zeigt sich, wie einfallsreich sie mit „jazzigen“ Reharmonisierungen arbeitet, das Original ist kaum noch zu erkennen: „Ich habe eine große Affinität zu Harmonien und Akkorden, die habe ich hier ausgelebt.“ Am lebhaftesten ist „Janana Sta Yama“, ein neckisches Stück der Schauspielerin Gulnar Begum.
Nie zuvor war Tanders Stimme ein so selbstsicheres, spielerisches Werkzeug. Vermehrt arbeitet sie nun mit Schichtungen. Eine der Eigenkompositionen, „Woken Dream“, zugleich einer der stärksten Momente des Werks überhaupt, zeigt, wie ein Song dadurch Zugänglichkeit auch für Hörende aus der Popkultur schaffen kann. „Natürlich ist es kein Pop-Album geworden“, stellt Tander klar. „Aber ich hatte schon den Wunsch, mich auf eine Art und Weise ganzheitlicher auszudrücken, weg von einer Nische zu gehen.“ Hier und da ist subtile, aber präsente Elektronik zu hören, getriggert von Rohrer am Schlagzeug. Überhaupt legt Simin Tander sehr viel Wert auf die Charakteristik des Sounds. Daher war es ihr wichtig, für den Mix und das Mastering Persönlichkeiten mit ausgeprägt „physischer Präsenz“ am Pult zu suchen. Gefunden hat sie sie im zweifach Grammy-nominierten Joshua Valleau und im Grammy-Gewinner Daddy Key, die mit der US-Pakistanerin Arooj Aftab, mit Kamasi Washington und Corinne Bailey Rae gearbeitet haben.
Ganz dem Wesen des Windes entsprechend schweift das Geschehen grenzenlos zwischen Indien und Afghanistan, dem Norden und Süden Europas und Amerika. Unser Interview findet in der heißen Phase vor der Bundestagswahl statt, die mit den bekannten Ereignissen die Selbstverständlichkeit solch schlagbaumloser Diversität künftig in Frage stellt. Mischt Simin Tander sich als kosmopolitische Künstlerin in politische Diskussionen ein? „Es geht heutzutage nicht mehr, dass man unpolitisch ist. Früher habe ich immer gesagt, dass mein Wunsch sehr persönlich ist, nämlich, den Reichtum der afghanischen und paschtunischen Kultur in die westliche Welt zu bringen. Das ist immer noch mein Hauptanliegen. Aber wenn es sich richtig anfühlt, mich nicht von der Musik zu sehr wegbringt, spreche ich jetzt auf der Bühne über Frauenrechte und die Situation in Afghanistan. Das ist auch eine Verantwortung, die ich als Künstlerin habe.“
Simin Tander: „Nursling Of The Sky“
Quelle: youtube
© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing, Ausgabe 159


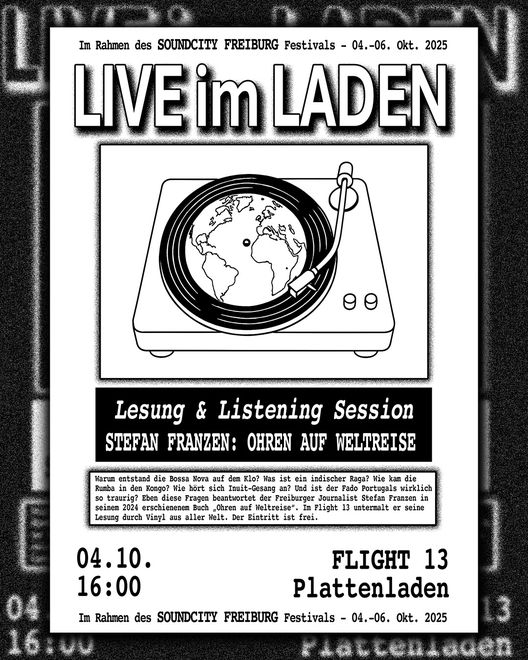

 Foto: Edwin van der Sande
Foto: Edwin van der Sande






