 Ein simpler Halbton auf der Bouzouki – und jeder wusste Bescheid, was da kommt. Absteigend über mehrere Stufen, wiederholt mit Verzierungen, schließlich mündend in einen rasanten Sirtaki. Wer ab Mitte der 1960er aufwuchs, konnte diesem Instrumental nicht entkommen. Die soghafte Titelmelodie aus „Zorba The Greek“, der Verfilmung eines Nikos Kazantzakis-Romans mit Anthony Quinn in der Hauptrolle, ist einer der großen Welthits seit 55 Jahren. Mikis Theodorakis, der Mann, der diese Musik geschrieben hat, ist nun im fast biblischen Alter von 96 Jahren in Athen gestorben.
Ein simpler Halbton auf der Bouzouki – und jeder wusste Bescheid, was da kommt. Absteigend über mehrere Stufen, wiederholt mit Verzierungen, schließlich mündend in einen rasanten Sirtaki. Wer ab Mitte der 1960er aufwuchs, konnte diesem Instrumental nicht entkommen. Die soghafte Titelmelodie aus „Zorba The Greek“, der Verfilmung eines Nikos Kazantzakis-Romans mit Anthony Quinn in der Hauptrolle, ist einer der großen Welthits seit 55 Jahren. Mikis Theodorakis, der Mann, der diese Musik geschrieben hat, ist nun im fast biblischen Alter von 96 Jahren in Athen gestorben.
Auch wenn sein „Zorba“ der einzige Berührungspunkt zwischen Millionen Menschen und ihm gewesen sein mag: In seiner fast ein Jahrhundert währenden Vita spiegelt sich Zeit- und Kulturgeschichte – nicht nur die griechische – wie in ganz wenigen anderen Biographien. Dreimal inhaftiert und gefoltert, aber auch dreimal Mitglied des Parlaments. Volksheld und Staatsfeind. Kommunist, aber auch Parteiloser. Komponist von angeblich 1000 Liedern, aber auch symphonischer Bombastiker. Im Zentrum seines musikalischen wie politischen Wirkens stand dabei stets die Suche nach Freiheit und Frieden.
1925 auf der Insel Chios geboren, begeistert er sich früh für verschiedenste Volksmusiken, die er durch häufige Umzüge der Familie kennenlernt, er schreibt Lieder, gründet einen Kirchenchor. Genauso früh wird Theodorakis politisch aktiv: Er arbeitet im Widerstand gegen die Nazis, landet, kaum volljährig, im Gefängnis, die Befreiung Athens gestaltet er auf Seiten der Linken mit. Der anschließende Bürgerkrieg bringt ihm wiederum Haft und Folter in der Strafkolonie auf Ikaria ein, nur knapp überlebt er das Martyrium. Auf Kreta kann er erstmals als Orchesterchef arbeiten, studiert in den 1950ern in Paris bei Olivier Messiaen. Theodorakis‘ erste Erfolge liegen in der klassischen Sphäre: Ballettmusiken, Sonatinen, Filmmusiken, ein symphonisches Debüt, das sein Beitrag zur Versöhnung nach dem Bürgerkrieg ist. Versöhnung geschieht bei ihm auch stilistisch: Die Tonleitern der Volkskulturen lässt er in seine Orchesterwerke einfließen, er sieht das hellenische Rohmaterial als geeignetes Mittel, die Krise der modernen Kunstmusik zu bewältigen. Und in den Liederzyklen, beginnend mit „Epitaphios“, verknüpft er pionierhaft ländliche Folklore mit dem Rembetiko, der urbanen Musik, die in den Hafenkneipen entstand. Grigoris Bithikotsis singt sie zunächst, doch ab der „Ballade von Mauthausen“ wird 1963 Maria Farantouri die herausragende Interpretin seiner Gedichtvertonungen, mit denen er Volksmusik auf eine höhere Stufe heben will.
Politisch erlebt Theodorakis in den 1960ern und 70ern die gewaltigen Eruptionen seines Landes mit: Zunächst ist er Abgeordneter für die Linken, als 1967 die Obristen putschen, geht er in den Untergrund. Als eine solche Bedrohung empfinden sie ihn, dass sie per Armeebefehl das Singen und Hören seiner Musik, sogar den Besitz seiner Platten unter Strafe stellen. Auf Druck von Leonard Bernstein, Harry Belafonte und Dmitri Schostakowitsch kommt er aus erneuter Folter frei, unterstützt den Kampf gegen die Faschisten von Paris aus, wird zur Symbolfigur der europäischen Studentenbewegung. Währenddessen entsteht sein genauso gewaltiges wie lyrisches Oratorium „Canto General“, eine Vertonung von Pablo Neruda-Texten.
Nach dem Sturz der Junta ist er ein Volksheld, er wird 1981 zum zweiten Mal ins Parlament gewählt, wo er sich für Erziehung und Kultur einsetzt, ebenso für die Aussöhnung mit der Türkei, die er auf der Bühne auch mit dem Sänger Zülfü Livaneli zelebriert. Weitere Symphonien entstehen, Opern mit antikem Mythen-Stoff, und er wirkt in Athen als Generalmusikdirektor des Orchesters von Rundfunk und Fernsehen. Man schlägt ihn für den Friedensnobelpreis vor, die UNESCO ehrt ihn. Und bis ins hohe Alter meldet er sich politisch zu Wort, gegen Krieg und faschistische Umtriebe, zuletzt als Initialfunke der Bürgerbewegung Spitha. Die Musik bildete für ihn sowohl die „individuelle menschliche Tragödie“ ab als auch eine völkerübergreifende „universale Harmonie“. Für beides stand sein Leben und Schaffen, das so viel mehr war als „Zorba The Greek“.
© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 3.9.2021

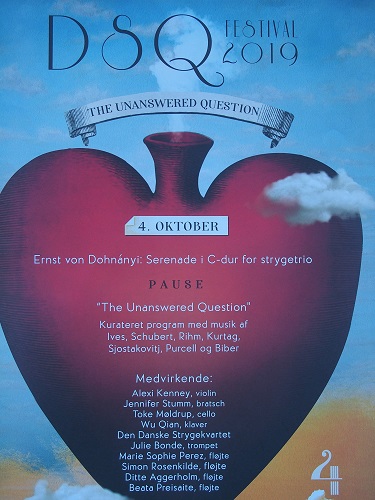



 alle Fotos © Stefan Franzen
alle Fotos © Stefan Franzen