
Die Berner Bassistin und Bandleaderin Eva Kesselring, die sich als Künstlerin Eva Kess nennt, hat mitten in Zeiten des Social Distancing ein Kunststück fertiggebracht: In den Winterthurer Hard Studios spielte sie mit 14 Musikern innerhalb von drei Tagen ein Large Ensemble-Album ein. Die Botschaft dieses Albums ist einfach, die Musik aber spannend und komplex. Mit Eva Kess habe ich über den „Inter-Musical Love Letter“ für die Sendung Jazz & World aktuell auf SRF 2 gesprochen. Ausstrahlung ist am Dienstag, den 08.02. ab 20h, Wiederholung am 11.02. ab 21h. Die Sendung ist im Live-Stream zu hören, in der Schweiz auch im Podcast danach.
Jahresernte
Aktuelle Empfehlungen, potentielle Schonjetztklassiker, neue Begrünungsflächen im wüsten Klangalltag
Wundbrand und Tröstung

Lady Blackbird
Black Acid Soul
(Foundation Music/BMG)
Zwei Akkorde, pendelnd wie ein sanft angestoßenes Glockenwerk. Darüber glitzernde Tröpfchen der Improvisation, ein ruhig schreitender Bass darunter. Das Klavier scheint aus einem riesigen Saal herauszutönen. Und dann: diese großartige Stimme, rau und doch besänftigend, man will sich in sie hineinbetten. „Wenn du ganz verloren bist, verfinstert und geschunden, wenn dein Herz unter Anklage steht, dann werde ich das für dich in Ordnung bringen. I will fix it for you.“ Die dunkle Stimme in diesem Trostlied für Erwachsene, das auf dem „Peace Piece“ des Pianisten Bill Evans beruht, gehört Marley Munroe aus L.A. Unter dem Pseudonym Lady Blackbird erwirbt sie sich gerade den Ruf als eine der aufregendsten Newcomerinnen im Vokalfach.
Als sie den jetzigen Namen noch nicht trug und in New York wirkte, durchlebte Munroe eine andere Klangwelt. Ihre Musik tönte knallig und überproduziert, R&B-Stangenware mit Drum-Maschinen, E-Gitarren und schwülen Strings, sie inszenierte sich als Vamp, auch gerne mal mit SM-Maske. Zuvor hatte sie in Nashville christliche Musik gemacht, getreu ihren Wurzeln im Gospelgesang. Der Schwenk kam durch die Begegnung mit dem Produzenten Chris Seefried, mit dem sie in den Sunset Sound Studios von Hollywood eine völlig neue Philosophie erarbeitete. Und die hieß: radikale Reduktion. Ein Steinway-Flügel im Hallraum, eine auf Sparflamme zischende Orgel und der faserige Hauch des Mellotrons (für alle verantwortlich: Deron Johnson), sowie der souveräne, virile Bass von Jon Flaugher: Kaum mehr braucht es. Wenige Male wird ein abgespecktes Schlagzeug bemüht, spartanische Gitarrentöne, einmal die Trompete von New Orleans-Größe Trombone Shorty. Denn so bleibt die Lady mit ihrer Stimme im Spotlight, mal tröstlich im Pianissimo, oft aber verletzt und fiebrig. Und in den exaltierten Passagen wie ein akustischer Wundbrand, der sich in die Seele der Hörenden fräst.
Lady Blackbird fasst ihren Liedzyklus unter dem Titel Black Acid Soul, der weniger ein Stilbegriff als eine Haltung ist. „Diese Aufnahme wurde zur Welt gebracht in L.A., aber getragen wird sie vom weltweiten Geist der untergründigen schwarzen Musik“, schreibt sie in den Liner Notes der CD. Trotz dem Mangel an Eigenkompositionen ist Black Acid Soul kein Cover-Album. Denn das kleine Team erfindet all die reinterpretierten Songs neu, destilliert aus ihnen die Essenz des Zeitlosen. Mehr noch: Es kommt einem vor, als seien die Originale, 50, 60 Jahre alt, bisher nur halb geöffnete Blüten gewesen, die sich erst jetzt ganz entfalten. Da ist erst einmal das namensgebende Stück „Blackbird“: Nina Simone hat es 1963 bereits gesungen, a cappella, als schmerzliches Porträt der schwarzen Frau in einem rassistischen Amerika, die sich in die Freiheit nicht emporschwingen kann. Zwar hat Munroe es vor dem George Floyd-Trauma eingesungen, aber unfreiwillig wird es bei ihr jetzt zum Soundtrack für den Rückfall Amerikas. Die finale Textzeile ein Aufschrei, wie eine Verurteilung: „You Ain’t Never Gonna Fly!“
In den Southern Soul-Nummern „It’s Not That Easy“ und „Ruler Of My Heart“ (ursprünglich von Reuben Bell und Irma Thomas) verzichtet sie auf Bläser oder Chöre und schraubt nur mit ihrer Solo-Stimme das Klage-Potenzial enorm hoch. Ähnliche Konzentration der Mittel in „Collage“: Für das Original spannte die James Gang aus Ohio noch gleißende Streicher ein, Lady Blackbird gestaltet es mit raffinierten vokalen Overdubs und ein paar peitschenden Beckenschlägen dramatisch aus. Und Tim Hardins Ballade „It’ll Never Happen Again“, einst eine recht verträumte Folkballade, reinkarniert hier in großen Soul-Phrasierungen als verzweifelte Hymne des Entliebens. Wie sich hier der Geist einer Ära erneuert, die sich von Sam Cooke bis zum Psychedelic Rock zieht, erfasst man beim Hören ganz intuitiv. Oder besser: Man wird erfasst von diesem Geist, eingehüllt. Denn Black Acid Soul macht süchtig.
© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung vom 1.2.2022
Lady Blackbird: „It’ll Never Happen Again“
Quelle: youtube
Hölzerner Hauch
 Foto: Urszula Las
Foto: Urszula Las
Man kann ihn sich als einen Steuermann vorstellen, der mit seinem fünfsaitigen Kontrabass am Bug einer wendigen Karavelle steht und durch musikalische Gefilde und Jahrhunderte navigiert. Nicht umsonst hieß eine seiner herausragenden Platten vor zwanzig Jahren „Navigatore“. Renaud Garcia-Fons‘ Spielphilosophie war es seit den 1990ern, Geographien und Epochen miteinander zu verbinden, Klänge des Mittelmeers und des Nahen Ostens mit der Alten Musik und Barock, Jazz mit musique du monde. „Main dans la main“, nennt er seine Verzahnungs- und Verschränkungstechnik im Interview, Hand in Hand gehen die Stile und Orte bei ihm, stehen nicht als bloße Blöcke nebeneinander. Und das macht auch sein neues Werk „Le Souffle Des Cordes“ (e-Motive Records/Galileo) so faszinierend.
„Ich hatte dieses Projekt schon lang im Hinterkopf, als Orient-Okzident-Komplettierung einer Trilogie, die mit ‚Silk Moon‘ und ‚Farangi‘ begann, Duos mit dem türkischen Stachelgeiger Derya Türkan und der Lautenistin Claire Antonini. Meine Idee war, jetzt ein klassisches Streichquartett einzusetzen, und zwar abseits seines üblichen Klanges. Sie sollten von der Rolle der Solisten auch immer wieder in die Begleitung wechseln, rhythmischere Parts spielen.“ Zum Quartett, dessen Prímás Florent Brannens der Bassist schon durch ein Teamwork für die France Musique-Sendung „alla breve“ kannte, tritt Türkans Kemence und die orientalische Kastenzither Kanun von Serkan Halili. Die Wahl des Albumtitels mag bei der Beschränkung auf Saiteninstrumente zunächst irritieren, man hätte ihn vielleicht eher bei Bläsern vermutet. Nun ist das französische Wort „souffle“ mit dem deutschen „Atem“ aber nur unzureichend übersetzt. „Souffle“ meint auch den Hauch, das Rauschen und Zischen, den spirituellen und poetischen Odem. Und davon gibt es genug während der knappen Stunde, die die zwölf Kompositionen dauern.
Allein schon durch den rauchigen, obertonreichen Klang der Kemence wird man ins Rauschhafte entrückt, oft lassen sich der in schwindelerregenden Lagen gespielte Bass und die Stachelgeige kaum auseinanderhalten. Zum Beispiel im schwebenden Tanz von „Le Bal Des Haftan“: „‘Haftan‘ ist das persische Wort für sieben und bezeichnet sieben hochentwickelte spirituelle Wesenheiten, die unseren Erzengeln ähneln“, führt Garcia-Fons aus. „Ich stellte mir hier vor, wie diese Wesen miteinander in Dialog treten und tanzen, in einer sehr würdevollen Art und Weise.“ An anderer Stelle, in „Jinete Viento“ zeichnet er ein positives Gegenbild zum düster-morbiden Gedicht „Canción De Jinete“, in dem ein Pferd einen toten Reiter trägt. „Meine Revanche an Garcia Lorca“, schmunzelt Garcia-Fons. „Bei mir wird der Reiter zum Pizzicato im rasanten Bulería-Rhythmus vom Sturm hinweggetragen, und am Schluss jongliere ich mit der Melodie des Revolutionsliedes der spanischen Republikaner.“
Poetische Anspielungen gibt es zuhauf: Jedem Stück hat der belesene Franko-Katalane im CD-Booklet einen Vers aus der Weltliteratur zur Seite gestellt, als imaginative Orientierungsmarke für seine Hörerschaft. Im vielleicht schönsten Stück, „Mamamouchi“, bemüht er einen Charakter aus Molières Farce „Le Bourgeois Gentilhomme“: „Wie Molières lachhafte Figur, die zu einer Art türkischer Sultan wird, trägt auch mein Stück humoristische Züge. Man hört Sequenzen aus dem Barock im Vivaldi-Stil, taucht dann in eine festliche osmanische Sphäre ein, findet sich dann in einem spanischen Fandango wieder. Ein Spaziergang zwischen den Welten, der aber mit sehr großer Präzision gespielt werden muss!“ Ähnlich traumwandlerische Brückenbauten gelingen dem Ensemble in „Qi Yun“, wo afrikanische und asiatische Pentatonik verwoben werden, sich ein interkontinentaler Blues entspinnt.
Es muss fast scheitern, einen so besonnenen und bescheidenen Menschen wie Renaud Garcia-Fons am Schluss des Gesprächs danach zu fragen, wie er seine Perfektionierung auf dem Bass während der letzten drei Jahrzehnte selbst einschätzt: „Weiterentwickelt habe ich vielleicht das ‚pizz di arco‘, die Technik, mit der ich die Oud nachahme. Und meine Phrasierung konnte ich beim Bogenstrich ein wenig mehr jazzy gestalten. Da gibt es keinen Bruch, nur Kontinuität. Einen höheren Grad an Reife? Ich hoffe es.“ Der „souffle“ auf seinem neuen Werk jedenfalls, er ist atemberaubend.
© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing #142
Renaud García-Fons: „Animame!“
Quelle: youtube
Von Rilke zu Rumi

Das neue Jahr beginnt mit starken Frauenstimmen.
Sie stammen alle von Alben, die bereits 2021 veröffentlicht wurden, aber zeitlose Musik beherbergen und eine Brücke vom Balkan und Bosporus über Persien bis nach Pakistan bauen. Und sie setzen alle außergewöhnliche Poesie zu Tönen.
Die US-Songwriterin Becca Stevens hat sich mit dem türkisch-armenisch-mazedonischen Secret Trio zusammengetan und in einer gemeinsamen Session, das fürs Label Ground Up von Snarky Puppys Michael League mitgeschnitten wurde, einen becircenden Sound zwischen Anglo-Folk und Nahost gefunden. Ihr „Pathways“ beruht auf Rilkes kurzem Gedicht „Weißt du, ich will mich schleichen“.
Die US-iranische Sängerin Katayoun Goudarzi verleiht mit Poesie des Sufi-Dichters Rumi den langen Stücken auf This Pale (Lycopod Records) des nordindischen Sitaristen Shujaat Husain Khan spirituelle Tiefe. Khan hatte schon auf vorangegangenen Alben seiner Liebe zum indisch-persischen Klangbogen gehuldigt.
Und die dritte im Bunde ist die US-Pakistani Arooj Aftab: Auf Vulture Prince (New Amsterdam) hat sie neue Wege gefunden, ebenfalls Verse aus der Sufi-Dichtung ins 21. Jahrhundert zu übersetzen – mit Akustikgitarre (Gyan Riley, der Sohn des Minimal Music-Pioniers Terry Riley) und keltischer Harfe (Maeve Gilchrist).
Ich hoffe, dass diese friedliche Musik die Stimmungsmarke für ein Jahr setzt, in dem es für uns alle ein bisschen leichter und lichtvoller wird.
Arooj Aftab: „Baghon Main“ (live at KEXP)
Quelle: youtube
Shujaat Husain Khan & Katayoun Goudarzi: „Wild“
Quelle: youtube
Becca Stevens & The Secret Trio: „Pathways“
Quelle: youtube
Verzahnte Raffinesse
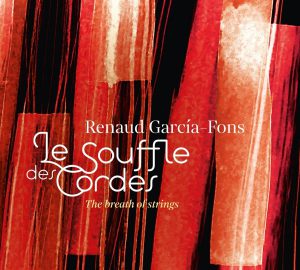 Renaud García-Fons
Renaud García-Fons
Le Souffle Des Cordes
(e-motive records/Galileo)
Seit den 1990ern ist es die Philosophie des franko-katalanischen Kontrabassisten Renaud García-Fons, Geographien und Epochen miteinander zu verbinden, Klänge des Mittelmeers und des Nahen Ostens mit der Alten Musik und Barock, Jazz mit musique du monde. Auf seinem neuen Werk tut er das nur mit Saiteninstrumenten. Sechs Streicher, ein Hackbrett, eine Flamencogitarre: Das ist die schlanke Rezeptur, aus der ein Füllhorn an Imaginationen zwischen Spanien, Frankreich, Balkan, Persien und China erwächst. Der Titel „Le Souffle Des Cordes“ könnte zunächst etwas verwirren. Atmende Streicher? Doch „souffle“ meint auch den Hauch, das Rauschen und Zischen, den spirituellen und poetischen Odem. Und davon gibt es genug während der knappen Stunde.
Etwa im schwebenden, obertonreichen Tanz der Stachelgeige Kemence während „Le Bal Des Haftan“. Im unmerklichen Wechsel von chinesischer Fünftonskala zum Mali-Blues in „Qi Yun“, oder im fliegenden Bulería-Rhythmus von „Jinete Viento“, inspiriert durch ein Gedicht von Federico García Lorca. Am schönsten funktioniert die Verzahnung der Stile in „Mamamouchi“, einer Molière-Figur nachempfunden: Von Vivaldi zu osmanischen Tönen und hinein in eine spanische Fandango geht diese rasante Humoreske. Mehr zu Renaud García-Fons‘ neuem Werk gibt es am 14.12. auf SRF 2 Kultur in meinem Interview-Beitrag über ihn: in der von Roman Hošek Sendung Jazz & World aktuell ab 20h, Wiederholung am 17.12. ab 21h.
Die Nächte reden mit mir

Der persische Santurspieler Kioomars Musayyebi baut auf seinem neuen Album A Voice Keeps Calling Me Brücken vom Iran über den arabischen Raum bis zur Alten Musik Europas.
„Schon im Iran wollte ich so viele Kulturen wie möglich kennenlernen“, sagt Kioomars Musayyebi. „Denn ich bin überzeugt, dass Musik eine gemeinsame Sprache ist, in der wir ohne Worte miteinander reden können, auch wenn die Gesellschaften durch die jeweilige Kultur und verschiedenen Rituale ein wenig auseinandergegangen sind. Nur der Dialekte, die Akzente sind anders.“ Aufgewachsen ist Musayyebi im Teheran. Dass er zur Musik kam, ist seinem Vater zu verdanken, der selbst kurdische Lieder sang und aus seinem Sohn einen Künstler machen wollte. Er gab ihn in die Obhut des größten persischen Meister auf dem Hackbrett Santur, Faramarz Payvar, der den Jungen nicht nur für das Instrument begeisterte: „Bei Payvar Schüler zu sein, das hieß, auch eine Philosophie fürs Leben mitzubekommen. Er war ein ganz besonderer Pädagoge.“ Bis heute verdankt Musayyebi seinem Meister viel, hat aber natürlich den Spielstil weiterentwickelt, ihn auch mit Techniken des Payvar-Schülers Parviz Meshkatian bereichert.
Sein Bedürfnis, über die klassische persische Musik hinauszuschauen, konnte Musayyebi im Iran nur begrenzt umsetzen. Daher kam er 2011 nach Hildesheim, wo er an der Musikhochschule rege Aktivitäten entfaltete: „Dort gab es viele Möglichkeiten für mich, etwas auszuprobieren: Wie klingen meine persischen Wurzeln zusammen mit arabischer Musik, mit Jazz, Weltmusik und anderen Instrumenten?“ Seitdem spielt der heute in Essen lebende Komponist in einer Vielzahl von Ensembles, um diese Begegnungen auszuloten, etwa im Transorient Orchestra, im Nouruz Ensemble oder in der Band Beyond The Roots, die sich letztes Jahr als multinationales Kollektiv um die Kölner Klarinettistin Annette Maye gegründet hat. Um eine ganze Bandbreite von Facetten auf einem einzigen Album unterzubringen, hat Kioomars Musayyebi auf A Voice Keeps Calling Me (Pilgrims Of Sound) acht Stücke für verschiedene Besetzungen mit Streichern, Blas- und Zupfinstrumenten versammelt.
„Es sind die unterschiedlichen Melodien in meinem Kopf, die mich rufen“, erklärt Musayyebi seinen Kompositionsprozess. „Ich denke beim Schreiben überhaupt nicht unbedingt an die Santur. Manchmal komponiere ich am Klavier oder auf der Sitar, manchmal zieht es mich zur Alten Musik, nach Persien oder in den arabischen Raum. Es kann sein, dass die Klarinette in meinem Kopf sagt: Ich muss diese Melodie spielen, oder einmal die Geige, oder sie tun sich in meiner Vorstellung zusammen. Und langsam reift die Idee: OK, dieses Stück gehört diesem oder jenem Ensemble.“ Die Melodien seien wie Stimmen, die ihn rufen, daher auch der Albumtitel, den er zugleich einem Gedicht von Sohrab Sepehri entlehnt hat. Vom großen Poeten der iranischen Moderne empfängt er in allen Lebens- und Gemütslagen Einflüsse.
Auf A Voice Keeps Calling Me wird es gerade wegen des ständigen Wechsels der Besetzungen, der unterschiedlichen „Stimmen, die rufen“, nie langweilig: Im Eröffnungsstück „Entezar“ bringt Musayyebi seine Sehnsucht nach Indien zum Ausdruck, indem er seinem indischen, ebenfalls in Deutschland lebenden Kollegen Hindol Deb eine prominente Solorolle zugesteht. „Djozz“ ist eine Widmung an den Mitmusiker Bassem Hawar und seine irakische Stachelgeige „Djoze“, gleichzeitig ein Paradestück für eine Suite, die zwischen Europa, dem arabischen Raum und Persien vermittelt. „Als ich im Iran lebte, hatten wir diesen achtjährigen Krieg mit dem Irak“, erinnert sich Musayyebi. „Und hier in Deutschland war der Iraker Bassem Hawar einer der ersten Musiker, die ich kennengelernt habe. Wir haben viele Stunden geredet und gemerkt, dass wir beide die gleichen Gefühle haben, dass unsere gemeinsame Musik Frieden bringt.“
Im Titelstück hat Musayyebi eine Melodie reaktiviert, die aus einer Fernsehserie stammt, die er als Kind im Iran gesehen hat. Nach 30 Jahren in seinem Kopf kommt sie nun zu neuen Ehren. Mit Annette Maye und dem Beyond The Roots-Ensemble wurde die lange Improvisation „Igra“ als spannender Hybrid zwischen Jazz und eurasischer Musik kreiert. Schließlich zwei Nachtstückchen, die zum einen ganz in die persische Klassik zurückführen („Nächtliches Geflüster“), zum anderen mit dunkler Flöte und schnurrender Djoze wunderbar dunkle Klangfarben erzeugen („Letzte Nacht“): „Die Nächte reden mit mir, in den Nächten kann ich gut denken und mich wohlfühlen“, sagt Musayyebi. „Jede Nacht könnte auch die letzte sein: Vielleicht sehen wir uns morgen nicht mehr. Aber wir haben die Hoffnung, dass der Morgen kommt und alles wieder von Neuem beginnen kann.“ Bei all den Inspirationen, die Kioomars Musayyebi derzeit außerhalb seiner Heimat empfängt, zieht es ihn – auch wegen der problematischen politischen Situation – vorerst nicht zurück. „Ich möchte noch mehr von der Welt sehen. Da gibt es noch viele Stimmen in anderen Ecken, die mich rufen.“
© Stefan Franzen, erschienen auf qantara.de
Kioomars Musayyebi Quartet live
Quelle: youtube
Klänge für den Solarplexus
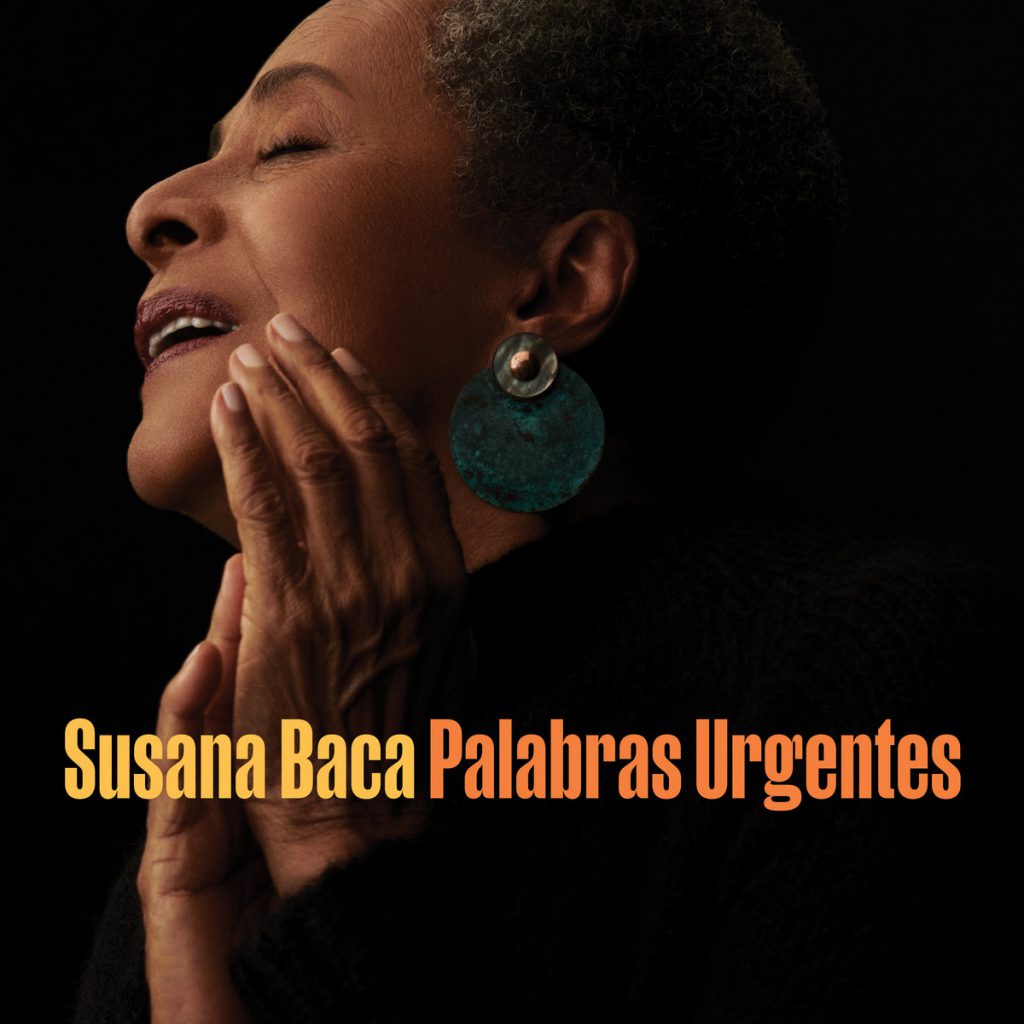
200 Jahre Unabhängigkeit ihrer Heimat, 50 Jahre Bühnenjubiläum Susana Baca: Über die runden Zahlen hinaus haben Peru und seine ikonische Sängerin eine enge musikalische und politische Beziehung. Mit „Palabras Urgentes“ setzt die einstige Kulturministerin ihr gesellschaftliches Engagement fort – und am Produktionspult stand Michael League von Snarky Puppy.
„Tocosh“ heißt eine natürliche antibiotische Medizin aus den Anden. Susana Baca beteuert, dass sie sich und ihre Stimme dank dieses „Inka-Puddings“ fit hält. Und in der Tat: Wer die neue Scheibe der 76-Jährigen, Palabras Urgentes (RealWorld) anhört, kann kaum einen Unterschied feststellen zu der klaren, kräftigen, resoluten Vokalkraft auf den Alben von vor zwanzig Jahren. Doch sonst ist eine Menge anders. „Das Album ist eine Meditation über das, was gerade in diesem Land passiert“, erzählt Baca in einer Live-Schalte aus Lima. „Das gesellschaftliche Klima hat sich wegen massiver Korruption drastisch verschlechtert, Politiker haben sich bereichert, Richter haben Freunde begünstigt. Im Volk hat sich eine Mischung aus Scham und Zorn breitgemacht. Ich konnte nicht mehr nur Poesie singen oder Liebeslieder. Zugleich wollte ich die Frauen ehren, die vor 200 Jahren eine so wichtige Rolle im Freiheitskampf gespielt haben.“
Namentlich sind das Micaela Bastidas, die Gefährtin des Rebellen Túpac Amaru II, die sie im Song „La Herida Oscura“ anspricht, und Juana Azurduy, die gegen die Spanier eine ganze Armee anführte. „Zum Jahrestag der Unabhängigkeit gab es eine Ausstellung, die mir gezeigt hat, dass Frauen sich organisieren müssen, um Beachtung zu finden,“ sagt Baca, und sie berichtet auch, dass sie bei den diesjährigen Wahlen Teil einer Ethik-Kommission war, die über faire Behandlung aller Bevölkerungsgruppen und Geschlechter wachte. Dabei sei viel Gewalt und Diskriminierung ans Tageslicht gekommen, selbst gegenüber Frauen, die schon in Machtpositionen waren.
All diese Schieflagen, dazu die dramatisch hohe Covid-19-Todesrate: Gibt es denn überhaupt etwas zu feiern zum Geburtstag von Peru? „Ja, ich habe Hoffnung“, so Baca. „Während der Pandemie haben die jungen Leute gesehen, wie unser Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Daraus ist ihr Wille entstanden, ein neues Land aufzubauen, sie entschließen sich jetzt vermehrt, nicht ins Ausland zu gehen, sondern hier vor Ort ihre Anstrengungen zu bündeln.“ Das wird in einem Land geschehen, das seit Juni von einem sozialistischen Lehrer aus der Sierra angeführt wird, Pedro Castillo.
Bacas Album Palabras Urgentes könnte der Soundtrack für dieses neue Peru werden. Seine Entstehung geht eigentlich auf das Jahr 2015 zurück, als die Band Snarky Puppy Lima besuchte, und Michael League Baca zur Teilnahme auf dem Album „Family Dinner II“ einlud. „Damals haben wir schon verabredet, dass er der musikalische Leiter für meine neue Scheibe werden sollte“, erinnert sich Baca, die internationale Kooperationen liebt, hat sie doch auf vergangenen Werken schon mit David Byrne, John Medeski, Marc Ribot oder Greg Cohen musiziert.
League hat den Sound des Albums, dessen Gros noch kurz vor der Pandemie eingefangen wurde, sehr vielfältig gestaltet: In „Negra Del Alma“ explodiert über dem Marimbaphon eine fulminante Blechblaskapelle, unter die sich das Saxophon des US-Amerikaners Jeff Coffin mischt, das Stück feiert ein Anden-Frühlingsfest. „Mein Lieblingssong, der geht direkt in den Solarplexus“, lacht Baca. In „Cambalache“ hat sie einen argentinischen Tango der 1930er mit afro-peruanischen Rhythmen adaptiert und den Text auf die jetzige Peru-Politik umgemünzt. Und in „Vestida De Vida“ singt sie mit großem Chor gegen die Klimakatastrophe an.
Am überraschendsten aber eine kurze Ballade namens „Dämmerung“: „Ich habe ein Gedicht von Luís Hernández Camarero, einem Dichter und Wissenschaftler vertont, der perfekt Deutsch sprach. Möglich, dass ich da auch Einflüsse von romantischen deutschen Komponisten verarbeitet habe, denn ich war ja oft auf Tour bei euch und habe eine Menge deutscher Musik gehört. Ihr wart das erste Land, in dem ich außerhalb Perus so richtig Anerkennung gefunden habe.“
Anerkennung ist auch das Stichwort, das Susana Baca verwendet, wenn sie über die Kultur der Afro-Peruaner spricht, für deren Sichtbarmachung sie Jahrzehnte gekämpft hat. „Ich dachte, wir hätten in puncto Rassismus Fortschritte gemacht. Aber es gibt immer noch Verachtung gegenüber den aus Afrika stammenden Küstenbewohnern, genau wie gegenüber den Indigenen aus Amazonien. Dabei ist der Reichtum dieser Gemeinschaft, die sich ‚Peru‘ nennt, gerade die Vielfalt in der Kultur. Damit sich diese Ansicht durchsetzt, müssen wir immer noch viel in unser Bildungssystem investieren.“
© Stefan Franzen, erschienen in Jazz thing #141
Susana Baca: „Sorongo“
Quelle: youtube
Synthese statt Exotik II
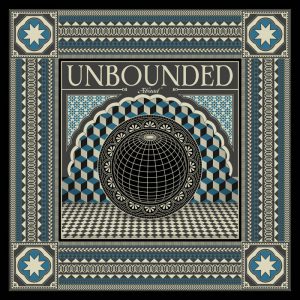
Purbayan Chatterjee
Abaad – Unbounded
(Sufiscore)
Die Dialoge zwischen Indien und dem Westen zeigen sich im Jahr 2021 gereift, haben die Stufe der exotischen Faszination, und auch die knallige Dancefloor-Philosophie des Asian Underground endgültig überwunden, wie gerade im letzten Beitrag zu Hindol Deb deutlich anklang. Auch der Sitarspieler Purbayan Chatterjee aus Mumbai versammelt auf Abaad – Unbounded eine internationale Riege von Bela Fleck über Snarky Puppy-Mitglied Michael League bis zum Landsmann Zakir Hussain. Chatterjee sieht sich in der Fusion-Anlage seiner brillant und weiträumig textierten Stücke in der Tradition von McLaughlins Shakti. Allerdings kredenzen die zahlreichen Auftritte prominenter indischer Vokalisten auch eine Süffigkeit („Firmament“), die weit weg vom Indo-Jazz siedelt. Für Zweifler sei „Lalitha“ als Anspieltipp genannt: Wie sich hier Flecks Banjo mit den rasanten Sitarlinien umwinden, ist grandios. Oder auch „Sukoon“ mit der Tabla von Zakir Hussain und der west-östlichen Vokalverwebung mit Thana Alexa und Gayatri Asokan.
Purbayan Chatterjee: „Sukoon“
Quelle: youtube
Der Schlüssel im Schnee
 Martha Wainwright
Martha Wainwright
Love Will Be Reborn
(Cooking Vinyl/Sony)
Die Wainwrights und Montreal, das ist eine Geschichte mit etlichen spannenden Kapiteln. Mit dem knarzig-zynischen Sänger Loudon Wainwright fing das in den Sechzigern an. Er heiratete Kate McGarrigle, die mit ihrer Schwester Anne franko-kanadisches Songwriting nicht nur in Folkkreisen bekannt machte. Und heute ist Kate und Loudons Sohn Rufus ein internationaler Star. Viel weniger bekannt ist bei uns seine Schwester Martha, unverdient: Denn Martha hat von ihrem Vater die bitterfeine Ironie, und von der Mutter diese ganz besondere Stimmkraft geerbt, die eindrucksvoll zwischen schneidender Resolutheit und ungeschönter Larmoyanz pendelt. Auf ihrem sechsten Album entlädt sich diese Kraft in einem Reigen kathartischer Songs.
„Dieses Leben zu leben, ist wie die Arbeit in einer Mine“, singt Wainwright im Song „Being Right“, und in „Rainbow“ sehnt sie sich nach der Leichtigkeit eines Regenbogens, der für Sekunden aufschillert und dann sterben darf. Toxisches Beziehungsende, Scheidung, Verlust von Liebe, Verlust auch eines Kindes im Sorgerechtstreit, all diese Umbrüche, zumeist selbst erfahren, formen Love Will Be Reborn. Wainwright ist dafür von New York in ihre Heimatstadt Montreal zurückgekehrt. Dort heißt ihr neuer Rückzugsort Café Ursa, eine Szenekneipe, die sie im Künstlerviertel Mile End eröffnet hat, nachdem sie das ganze Gebäude Immobilienspekulanten vor der Nase weggeschnappt hat. Der Keller diente ihr und Bandmusikern aus Toronto als Studio.
Schwankte der Vorgänger Goodnight City etwas ziellos zwischen Balladen und Punk, ist das neue Opus – gerade all der Verletzungen wegen – kraftvoller, geradezu trotzig geworden. Wainwright startet mit einer von E-Gitarre getragenen Liebeserklärung an den Rock’n Roll, der „dieses fürchterliche Leben lebenswert“ mache, schreit dann geradezu in höchsten Lagen ihr Ankämpfen gegen das Älterwerden in einer Art Country-Drama heraus. Die letzten, offenbar auch gewalttätigen Tage einer Beziehung arbeitet sie in „Body And Soul“ auf, und da wandelt sie sich zu einer so gequälten Furie, dass es einem das Herz zerreißt. In zärtlicher Verzweiflung, unendlich langsam entfaltet sie die Schmerzen einer Mutter, die allein im Haus zurückbleibt. Mit beiden Söhnen spielt sie im Videoclip zum Titelsong eine Mischung aus Artus- und Siegfried-Sage samt Plastikdrachen nach. Der verlorene Schlüssel zum Liebesglück, heißt es da, liegt tief im Schnee begraben, doch das Herz wird ihn im Frühling wiederfinden. Hymnisch und positiv ist dieser Song.
Nicht unbegründet, denn in „Hole In My Heart“ wird sie tatsächlich von neuer Liebe berichten, zu einem treibenden Arrangement, das sich in atemloser Glückseligkeit nach oben schraubt. Der außergewöhnlichste Moment aber am Ende: „Malaise De Falaise“, ein sprachspielerisches Bild für Höhenangst, ist eine schlafwandelnde Popballade über Pianotriolen, getextet in der für Montreal typischen Zweisprachigkeit: Zu Stimmverfremdungen, die richtig beunruhigend klingen, singt Wainwright: „Nachts klettere ich an den Klippen des Unwohlseins hinauf, regennass, ich zünde die Kanonen, zerreiße die Ketten.“ Starke Bilder einer starken Frau, die mit diesem Werk vielleicht ein wenig aus dem Schatten von Bruderherz Rufus treten könnte.
© Stefan Franzen
Martha Wainwright: „Malaise De Falaise“
Quelle: youtube
Brasilianischer Sommer-Hattrick

Den fürchterlichen Nachrichten aus Brasilien steht eine rege Kreativität von unbeugsamen Künstlern entgegen. Und die Geschichte wiederholt sich: Vor 50 Jahren war die damalige Musikergeneration in einer ganz ähnlichen Situation. Meine drei Kurzempfehlungen für einen nicht nur unbeschwerten Sommer-Soundtrack.
Rodrigo Amarante
Drama
(Polyvinyl)
Wer in den letzten Jahren aufmerksam die Brasil-Szene verfolgt hat, dem ist der Name Rodrigo Amarante nicht entgangen. Der ehemalige Kopf der Band Los Hermanos und der Sambagruppe Orquestra Imperial, Songschreiber für Norah Jones und Gilberto Gil veröffentlicht mit Drama jetzt sein zweites Soloalbum. Die elf Songs des weltläufigen Carioca mit jetzigem Wohnsitz L.A. haben eine immense Spannbreite. Akustische Dreampop-Momente becircen in „Tango“. Vernuschelte Bossa und Erinnerungen an Filmhits der Sechziger und die Melancholie eines Scott Walker zieren das Stimmungsbild, im herausragenden Track „Tao“ gleitet man in mild köchelnden Funk hinein – und stets ist alles schön räumlich mit Streichern und Blech aufgefächert. Ein nostalgisches Meisterwerk, das genauso unaufdringlich wie detailbesessen ist.
Rodrigo Amarante: „Maré“
Quelle: youtube
Lucas Santtana
3 Sessions In A Greenhouse
(Mais Um Discos/Indigo)
Fünfzehn Jahre nach dem ursprünglichen Release veröffentlicht Mais Um Discos ein frühes Meisterwerk des Songwriters Lucas Santtana für den hiesigen Markt. 3 Sessions In A Greenhouse enthüllt eine schwer experimentelle Phase des Mannes aus Salvador. Die acht Tracks, davon zwei Covers von Tom Zé und der Nação Zumbi, haben eine satte Dubphilosophie aufgesogen, sind unterfüttert von grandiosen Perkussionsgeflechten und schwelgen in bekifften Blechfanfaren. Durch das Remastering sind diese rauschhaften Klangschätze von 2006 nochmals räumlicher geworden.
Lucas Santtana: „Ogodô Ano 2000 (feat.Tom Zé)
Quelle: youtube
José Mauro
A Viagem Das Horas
(Far Out)
Die Wiederveröffentlichung von José Mauros Werk beamt uns ins Rio des Jahres 1970 zurück. Es ist nach Obnoxious der zweite Re-Issue des Londoner Labels, der sich mit dem heute nahezu vergessenen Musiker befasst, der gerade mal zwei Alben auf dem kleinen Label Quartin veröffentlichte. Schwüle Chansonmelancholie paart sich mit Samba-Unterbau, einem verhallten Streichorchester und der barocken Psychedelia eines frühen Milton Nascimento, die Mauro in die Nähe des Clube da Esquina-Sound rückt. Man hört in der omnipräsenten Schwermut dieser Songs förmlich, welche Bürde es für einen Freigeist gewesen muss, unter der Militärdiktatur zu existieren.
