beobachtet am 7.6.2018 zwischen 12 und 23h





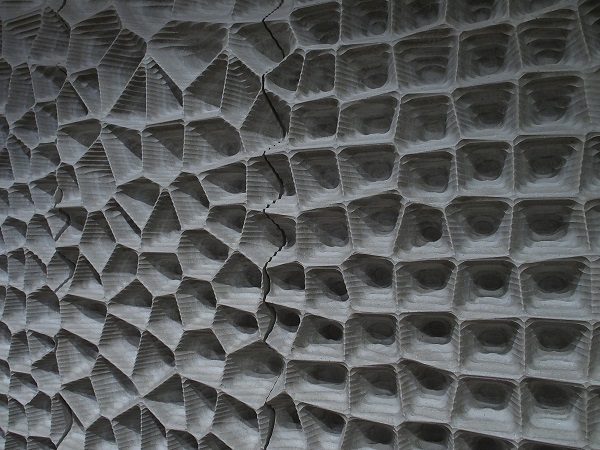











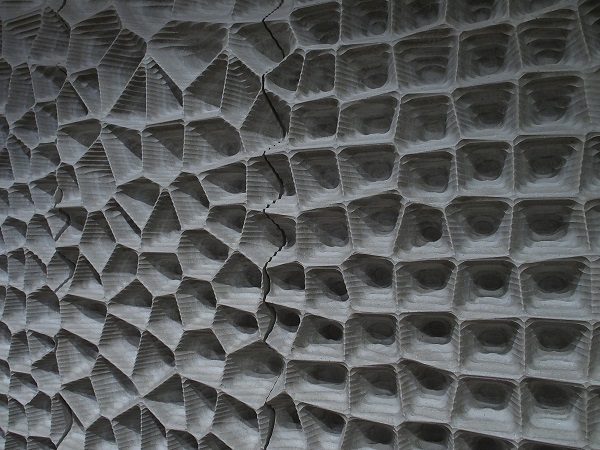






Feine Dinge, die dieser Tage 50 werden!
 Wer auf den Azoren weilt, ist auf Schritt und Tritt umgeben von geographischen Rekorden. Hier gibt es – eine kleine Felsnadel im Ozean mit Namen Monchique – den westlichsten Punkt Europas, die westlichsten Dörfer der Alten Welt, die westlichsten Leuchttürme, die westlichsten Hunde, Katzen, Mäuse, Menschen. Und natürlich kann man auf dem Archipel 1.600 Kilometer vor Portugals Küste auch den westlichsten Plattenladen finden, zugleich den einzigen der Inselgruppe. Er ist in der Hauptstadt Ponta Delgada zu finden und nennt sich – komplett unportugiesisch – „La Bamba“.
Wer auf den Azoren weilt, ist auf Schritt und Tritt umgeben von geographischen Rekorden. Hier gibt es – eine kleine Felsnadel im Ozean mit Namen Monchique – den westlichsten Punkt Europas, die westlichsten Dörfer der Alten Welt, die westlichsten Leuchttürme, die westlichsten Hunde, Katzen, Mäuse, Menschen. Und natürlich kann man auf dem Archipel 1.600 Kilometer vor Portugals Küste auch den westlichsten Plattenladen finden, zugleich den einzigen der Inselgruppe. Er ist in der Hauptstadt Ponta Delgada zu finden und nennt sich – komplett unportugiesisch – „La Bamba“.
 Bedingt durch ungünstige Winde auf der Insel São Jorge und Einstellung des Flugbetriebs als Folge erreichten wir am Ende unserer Reise über das atlantische Reich die Hauptstadt Ponta Delgada mit einem Tag Verspätung. Was den Besuch im „La Bamba“ auf einen engen Zeitrahmen von 20 Minuten zusammenschnürte. Etablissements mit Vinyl waren ohnehin nicht auf dem Zettel für diese Reise, doch wie es das Schicksal so will… Einer der ersten Sätze, die ich nach der Landung sagte, war: „Platten werden wir hier wohl nicht kaufen!“, woraufhin mir Minuten später, noch am Flughafen, eine Kulturzeitschrift mit einer ganzseitigen Werbeanzeige für den „westernmost record shop of Europe“ in die Hände fiel.
Bedingt durch ungünstige Winde auf der Insel São Jorge und Einstellung des Flugbetriebs als Folge erreichten wir am Ende unserer Reise über das atlantische Reich die Hauptstadt Ponta Delgada mit einem Tag Verspätung. Was den Besuch im „La Bamba“ auf einen engen Zeitrahmen von 20 Minuten zusammenschnürte. Etablissements mit Vinyl waren ohnehin nicht auf dem Zettel für diese Reise, doch wie es das Schicksal so will… Einer der ersten Sätze, die ich nach der Landung sagte, war: „Platten werden wir hier wohl nicht kaufen!“, woraufhin mir Minuten später, noch am Flughafen, eine Kulturzeitschrift mit einer ganzseitigen Werbeanzeige für den „westernmost record shop of Europe“ in die Hände fiel.

Wer das „La Bamba“ betritt, guckt zuerst mal bedröppelt aus der Wäsche, denn LPs sieht man hier nicht auf Anhieb. Der vordere Ladenteil ist eine Art Gemischtwarenladen mit Nippes für Touristen, Kinder-T-Shirts und Gebrauchsgegenständen für Azoreaner, hat sowohl Hippie- wie auch Popcharakter, und an der Theke steht ein jovialer Bartträger, weder azoreanischer, noch portugiesischer Provenienz. Pedro ist Spanier und betont gleich, dass er mit der hinteren Abteilung des Shops nichts zu tun hat. Und da hängt leider auch schon eine Kordel davor, die er für uns Besucher aus der Ferne aber dann doch schnell öffnet.

Die Tonträger-Abteilung des „La Bamba“ hat ausgesprochenen Wohnzimmercharakter. Ein Perserteppich über den Fliesen, Stand- und Hängelampen in Fünfziger- bis Siebzigeroptik, jede Menge Kofferplattenspieler von Crosley, Memorabilia von KISS bis Kraftwerk, zwei Hände voller Singles mit Brasil- und Israel-Raritäten auf einem Lederbänkchen, bunte Wandbemalung im Stile der Jazzbilder von Matisse. Hier lässt es sich verweilen, was wir aber leider nicht allzu lange können.

Unser Interesse gilt daher recht schnell den Vinylkisten, eine Handvoll sind es, angenehm und gepflegt befüllt. Wir registrieren Rock- und Soul-Second Hand-Ware, plagen den armen Pedro, der sich hier doch gar nicht auskennt, schnell mit der entscheidenden Frage: „Was davon ist azoreanisch?“ Mit Verweis auf sein Iberertum zuckt er entschuldigend mit den Schultern, hilft aber dennoch unermüdlich bei der Suche, während das Smartphone parallel musikgeographische Zuordnungsdienste leistet.

Da fällt uns eine farbenprächtige Platte in die Hände, ein stolzer Pfau posiert da vor Terracotta-Wand auf dem Cover, das Duo nennt sich Medeiros / Lucas, ihr Werk Sol De Março, und ja: Die beiden Herren stammen tatsächlich von den Azoren. Da unsere Zeit schon abläuft, ein mutiger Zugriff und sehr freundliche Verabschiedung vom hilfsbereiten Pedro. Wir haben den Kauf nicht bereut, wie die demnächst hier erscheinende Folge aus der Reihe Schatzkiste zeigen wird.

Fotos: Markus Kurz (Stefan Franzen 2), Text: Stefan Franzen








 „Legendäre, aber fast vergessene Chorsängerinnen suchen Popstar vom anderen Ende der Welt für zweiten Frühling“. So könnte, ein bisschen ironisch und überspitzt, die Anzeige gelautet haben, die zu diesem Treffen führte. Hier: ein zwanzig Stimmen starker Frauenchor aus Bulgarien, der weltweit Menschen zu Tränen rührt und dessen Mysterium bis heute unerklärlich scheint. Und dort: Eine australische Wave-Ikone, die seit 30 Jahren mit ihrer betörenden Stimme ein Publikum von Gothic bis Weltmusik fasziniert.
„Legendäre, aber fast vergessene Chorsängerinnen suchen Popstar vom anderen Ende der Welt für zweiten Frühling“. So könnte, ein bisschen ironisch und überspitzt, die Anzeige gelautet haben, die zu diesem Treffen führte. Hier: ein zwanzig Stimmen starker Frauenchor aus Bulgarien, der weltweit Menschen zu Tränen rührt und dessen Mysterium bis heute unerklärlich scheint. Und dort: Eine australische Wave-Ikone, die seit 30 Jahren mit ihrer betörenden Stimme ein Publikum von Gothic bis Weltmusik fasziniert.
„The Mystery Of The Bulgarian Voices“ und Lisa Gerrard von der Band Dead Can Dance: ein ungleiches Paar oder eine Traumhochzeit? Das habe ich in Köln im Interview mit Lisa Gerrard, der Chorleiterin Dora Hristova und Produzentin Boyana Bounkova versucht herauszufinden.
Der Titel der CD, BooCheeMish, klingt sehr lautmalerisch. Bedeutet er etwas Konkretes?
Boyana Bounkova: „BooCheeMish“, allerdings anders geschrieben, ist der Name eines Folkloretanzes im 15/16-Takt. Einem Stück auf dem Album liegt dieser Tanz zugrunde, das ist „Rano Ranila“. Wir haben ziemlich lange nach einem Namen für das Album gesucht und haben uns dann entschieden, diesen Namen zu verwenden, ihn aber absichtlich falsch zu schreiben und so auf eine Art Freiheit auszudrücken. Denn das ist der Geist des ganzen Albums. Unsere Musik und unsere Kultur kommuniziert darauf mit anderen Kulturen und Musikstilen anderer Kontinente. Wir dachten, wenn wir dieses Wort benutzen, das auf einen expressiven Tanz zurückgeht, dann ist das der Ausdruck von Freiheit. Der Geist des Albums ist dynamisch, groovy, offen.
Dora Hristova, Sie haben den Chor schon einmal 1974 geleitet und dann wieder ab 1988. Wie stellt sich die Arbeit mit den Frauen heute dar, ohne staatliche Unterstützung und mit der Konkurrenz durch andere Chöre wie Bulgarian Voices Angelite?
Hristova: Heute ist es sehr schwierig zu überleben, eben wegen der Konkurrenz zwischen den Chören. Aber wir versuchen die besten zu sein. Es gibt eine Krise, was das Repertoire angeht. Viele Arrangeure und Komponisten sind nicht mehr am Leben. Es braucht junge Leute, die sich für die Folklore interessieren. Am Konservatorium von Sofia findet die Musikerziehung im westlichen Stil statt. Der Unterricht in traditioneller Musik ist nicht so prominent. Wir haben eine Kunstakademie in Plovdiv, ich habe dort mehr als 10 Jahre unterrichtet. Doch die traditionelle Musik verursacht Schäden an den Stimmen der jungen Sängerinnen. Dazu kommt, dass die Tradition westlich beeinflusst ist und dadurch ihre Originalität verliert. Das sind die heutigen Probleme. Meine Mission war es, die Einzigartigkeit und Ursprünglichkeit dieses Chors, den Stil des Open Throat-Singings und das Repertoire zu bewahren. Vor drei Jahren haben wir die Leute von Schubert Music und natürlich auch Lisa kennengelernt und wir haben probiert, einen neuen Weg zu finden, dieses Nationalerbe, diesen Schatz weiterzuentwickeln. Und ich denke, wir waren erfolgreich! Weiterlesen
 Fatoumata Diawara
Fatoumata Diawara
Fenfo
(Wagram/Montuno/Indigo)
Sieben Jahre sind seit ihrem Debütalbum vergangen, und sieben Jahre sind eine lange Zeit, auch im vielleicht etwas langsamer mahlenden Weltmusik-Business. Doch man darf nicht vergessen, dass Fatoumata Diawara sich nicht ausschließlich als Sängerin sieht. Schon ihrem Debüt Fatou, für das sie als die neue Oumou Sangaré gefeiert wurde, ging eine Schauspielkarriere voraus, und die füllte auch einen Gutteil des Raums zwischen den beiden Alben: Im erschütternden Timbuktu des Mauretaniers Abderrahmane Sissako spielte sie eine Musikerin, die für ihren Beruf vom IS gesteinigt wurde, und in der Dokumentation Mali Blues erzählte sie ihre bittere Geschichte von Flucht vor Zwangsheirat und Beschneidung. Und ganz nebenbei war sie Studio- und Bühnenpartnerin von Herbie Hancock, dem kubanischen Pianisten Roberto Fonseca und Bobby Womack, setzte sich mit einem eigens komponierten Song für Einheit und Frieden im jüngst gebeutelten Mali ein.
Auch das Nachfolgewerk Fenfo kündet von ihrer entschlossenen Haltung. Übersetzt aus dem Bambara heißt der Titel: „etwas zu sagen“, die Themen drehen sich um Migration, Sehnsucht nach Liebe und die Erhaltung der Erde. Ein wenig tanzbarer („Nterini“, „Kanou Dan Yen“), auch rockig-funkiger („Kokoro“, „Negue Negue“, „Bonya“) ist ihr Afro-Folk geworden, das liegt an einem afropäischen Team, das um klingenden Ausgleich zwischen den Kontinenten bemüht war und diese Balance auch ganz gut hingekriegt hat. Federführend ist der Franzose -M- (Mathieu Chedid) am Pult und an der Gitarre, für die afrikanischeren Farben ist Sidiki Diabaté an der Kora da, und die lyrischen Passagen werden durch den Mali-erprobten Cellisten Vincent Ségal („Don Do“) gezaubert. In der Mitte siedelt Diawaras Stimme, die für die stolzen, pentatonischen Melodien ein wunderbares Transportmittel ist – und die sich ihrer Gebrochenheit nicht schämt, keine vokale Brillanz erzeugen möchte, sondern vor allem einen kraftgeladenen, aufrichtigen Ausdruck. Und das geht ganz ohne Auto-Tune.
© Stefan Franzen
live: 26.5. Hannover, Masala Festival, 30.5. Würzburg, Africa Festival, 28.6. Fort Kléber, Wolfisheim/F, 8.7. Rudolstadt Festival
 Dobet Gnahoré
Dobet Gnahoré
Miziki
(LA Café/Media Nocte/Indigo)
Afrikas Popmusik scheint derzeit in zwei große Lager zu zerfallen: Da tummeln sich immer noch die großen Stars der 1980er und 1990er, die auf Festivals hierzulande vom gealterten Weltmusikpublikum gefeiert werden. Auf der anderen Seite gibt es die von Electronica aller Art geprägte, globalisierte Urban Africa-Sparte, begeistert gefeiert in den Metropolen des Kontinents, hier aber kaum jemandem zu vermitteln. Und dazwischen? Vielleicht ist Dobet Gnahoré eine der wenigen, die einen Brückenschlag zwischen den beiden Polen zumindest ansatzweise versuchen. Mit ihrem fünften Album untermauert die Ivorerin, die im legendären Künstlerdorf Ki-Yi M’Bock aufgewachsen ist und fest in den Traditionen der Heimat steht, ihre Königinnenposition unter den westafrikanischen Sängerinnen.
Die zwölf Songs leben vor allem von einer grandiosen, souveränen Stimme, die, wie schon gleich im Opener „Djoli“, theatralische Qualitäten entfalten kann. Ganz wesentlich ist die Produktion vom feinfühligen Pultdirigat des Franzosen Nicolas Repac geprägt: Wie sich die „jodelnden“ Tonfolgen der Pygmäen, eine genauso swingende wie machtvolle Rhythmusgrundierung, wilde Flötentöne und die vokale Präsenz zu packenden Popsongs vereinen, kann in „Afrika“ und „Lobe“ abgelauscht werden. Im Titelstück ist eine Buschharfe als funkiger Taktgeber passgenau integriert, und als mitreißende Afrorock-Hymne präsentiert sich „Akissi La Rebelle“. „Detenon“ und „Love“ schlagen ruhigere Töne mit schönen Gesangssätzen und Balafon-Textur an. Und auch hier schwirrt wieder das kehlige Pygmäenjodeln herum, das überhaupt in vielen der Songs latent lauert und eine ganz wesentliche Klangfarbe von Miziki ist. Eine gelungene, trittsichere Gratwanderung zwischen dezenten Modernismen und traditionellem Selbstbewusstsein.
© Stefan Franzen
live: 2.6. Afrika Festival Würzburg, 23.06. Afrikanisches Kulturfestival Frankfurt, 30.6. Stattfest Freiburg, 5.7. Kulturfestival St. Gallen/CH
 Stefano Bollani
Stefano Bollani
Que Bom
(Alobar/Galileo)
Die vielen kulturellen Anknüpfungspunkte zwischen Italien, Brasilien und auch dem weitergefassten Latin-Raum hat Stefano Bollani auf seinem neuen Werk mit Finesse ausgereizt. Zunächst erweitert der italienische Pianist sein Stammtrio um zwei Perkussionisten, was eine detaillierte, durch Brummtopf bis Bongo aufgefächerte Rhythmusarbeit ermöglicht. Und dann baut er, weit über bloßes Namedropping hinaus, prominente Köpfe aus Übersee ein. Der ohnehin italophile Caetano Veloso hat einen starken Auftritt, wenn er über den Nebel von Neapel singt, gestützt durch Jaques Morelenbaums zartes Cellopastell. Hamilton de Holanda lässt sein bauchiges Bandolim in einem Baião tanzen, und João Bosco kleidet mit dem Italiener seinen Samba „Nação“ in ein intimes Jazzgewand. Voll balladesker Leuchtkraft sind aber auch die Momente der Kernbesetzung, etwa die vor ruhigem Lebensglück schillernden Stücke „Cente Giornate Al Mare“ oder „Criatura Dourada“. Dieses Werk macht sommertrunken.

Ein weißer Fleck auf der musikalischen Landkarte, gibt es das noch? Tatsächlich lässt sich mitten in Europa noch eine Klangkultur finden, die den akustischen Schatzsuchern weitestgehend entschlüpft war. Wer könnte von sich schon sagen, er wäre mit der Musik des albanischen Südens vertraut? Selbst der Amerikaner Joe Boyd, der seit den 1980ern durch sein Label Hannibal maßgeblich am Aufschwung der Weltmusik beteiligt war, hatte das kleine Land lange Zeit nicht auf dem Zettel.
Der schillernde Produzent war schon in den 1960ern beim Newport-Festival Produktionsleiter, als Bob Dylan zum Entsetzen der Folkies seine E-Gitarre einstöpselte. Er war 1967 für die erste Pink Floyd-Single verantwortlich, wurde Mentor des schwermütigen Songwriters Nick Drake und entdeckte die Folkrocklegenden von Fairport Convention. Seine wilden Sechziger beschreibt er in dem spannenden Buch „White Bicycles“. Im besten Alter, mit 75, hat Boyd jetzt aber noch mal ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. „Albanische Musik hatte mich schon seit einiger Zeit fasziniert“, erzählt er mir im Interview. „Das lag natürlich auch daran, dass man fast keinen Zugang zu ihr hatte, es gab kaum Platten. Es muss 1986 gewesen sein, dass ich Videos vom großen Festival in Gjirokastra sah. Es schien mir fast surreal: Diese Musiker mit den konischen Hüten, die wehenden Fahnen und die Bergkulisse im Hintergrund. Und dann diese polyphonen Gesänge namens Saze! Für mich war klar, da muss ich hin.“
Doch es dauerte fünfundzwanzig Jahre, bis ihn die BBC-Kollegin Lucy Duran für eine Sendereihe in den Südosten Europas mitnahm. Eine Reise, die für Boyd mehrere Konsequenzen hatte: Er lernte dort seine zukünftige Frau Andrea Goertler kennen, in Albanien für die Gesellschaft für Zusammenarbeit tätig und mit der dortigen Musik bestens vertraut. Zusammen mit ihr und weiteren Experten initiierte er das Projekt Saz’iso, in dem nun die besten Musiker der südalbanischen Polyphonie versammelt und auf einer CD verewigt sind. Die Sessions hat der feinfühlige Jerry Boys geleitet, der auch schon in Havanna den Buena Vista Social Club aufnahm.
Was ist nun das Einzigartige an dieser Musik, dem Saze? Auch all die, deren Ohren mit allen Wassern der exotischen Klänge gewaschen sind, müssen beim Lauschen an Stimmen aus einer anderen Welt denken. „Die Kombination eines Borduns mit zwei Stimmen, die sich improvisierend umkreisen, das gibt es meines Wissens nach nirgendwo anders auf dem Balkan“, sagt Boyd. Musikethnologen sprechen von „iso-polyphonisch“. Unter den genauso schneidenden wie warmen Stimmen liegt die Llautë, eine Laute mit Metallsaiten, Klarinette und Geige treten mit verzierungsreichem, schluchzendem Spiel hinzu. Die Instrumentalformen heißen „Vale“ und „Kaba“ – und mit letzterem verbindet sich eine berühmte Entstehungsanekdote: Als ein Mann über den nahen Tod seiner Ehefrau klagte, rief die vom Totenbett: „Hol deine Klarinette und lass sie an deiner Stelle weinen.“ Für uns ist der Gesamteindruck von Saze und Kaba trotz der manchmal tänzerischen Rhythmen in der Tat ausgesprochen melancholisch. “Die Geschichten sind sehr traurig“, bestätigt Boyd.
„Da singt etwa ein Schäfer, den Banditen töten werden, sein Abschiedslied. Emigrantenlieder sind dabei, denn viele Albaner mussten immer ins Ausland, um Arbeit zu finden, und ihre Familie erfuhr dann oft Jahrzehnte nichts über ihren Verbleib.“ Das ist auch ganz konkret der Fall bei den Musikern auf der CD: Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Apparats unter dem Autokraten Enver Hodscha gingen Saz’isos Sängerinnen Donika Pecallari und Adrianna Thanou beide nach Athen, ihre Musikausübung aufrecht zu erhalten, war schwierig. Die männliche Stimme dagegen, Robert Tralo, ist von Berufs wegen eigentlich orthodoxer Priester, tauscht abends das Messgewand für Auftritte bei Hochzeitspaaren, die er kurz zuvor in der Kirche gesegnet hat. „Hodschas Herrschaft war ein zweischneidiges Schwert“, urteilt Boyd. „Er liebte den Saze und förderte ihn, auf der anderen Seite hatte die Musik positiv zu sein, sollte den Sozialismus preisen. Heute gibt es die Zwangsjacke nicht mehr, aber eben auch keine Förderung.“
Der Saze ist von der UNESCO mittlerweile als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Doch wird das seiner Zukunft nützen? Boyd ist verhalten optimistisch: „Die stilbildenden Sänger und Instrumentalisten sind tot. Doch auf den Hochzeiten ist die Musik immer noch lebendig. Die Albaner lieben ihre Volkstradition und schauen nicht auf sie herab wie manche andere Länder, und es gibt auch ein paar junge Musiker, die neben Jazz und Rock den Saze spielen.“ Im Sommer lässt sich dank Saz’iso diese einzigartige Musik nun auf ausgesuchten Festivals auch in unseren Breiten erleben.
© Stefan Franzen
dieser Artikel erschien in der Zeitschrift Folker, Ausgabe 3/2018
Saz’iso live: Domizil Dortmund, 19.5., Rudolstadt-Festival 6. +7.7.

Idris Ackamoor & The Pyramids
An Angel Fell
(Strut/K7/Indigo)
Eine Kultband des Cosmic Jazz hat sich nach 35 Jahren zur Neuauflage zusammengefunden: The Pyramids sind seit 2011 mit ihrem charismatischen Leader Idris Ackamoor wieder im Geschäft. Fürs neue Œuvre An Angel Fell haben sie mit dem dem Produzenten Malcolm Catto (Heliocentrics) und seinem spooky Sound einen kongenialen Partner gefunden. Es oszilliert zwischen federndem Afrobeat in Eingangssstück „Tinoge“, unheimlichem Dub in „Land Of Ra“ und epischen Latin-Jams wie in der zornigen „Souloquy For Michael Brown“. Stets getragen wird das Geschehen von einem Leader, der sein Saxophon von zornigen Free-Ausbrüchen bis zu weichen Lyriklinien spreizt. Und im Dialog mit Sandra Poindexters Violine zaubert Ackamoor selten zu hörende Texturen – Anspieltipp dafür das launige „Papyrus“, das sich wie ungeschriebene Filmmusik zu einem orientalischen Science Fiction der 1930er anhört.