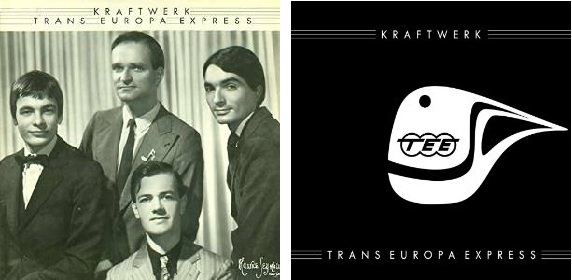Foto: Alex Kozobodis
Foto: Alex Kozobodis
Das Penguin Café ist kein konkreter Ort, es ist ein künstlerisches Idyll. Hier ist alles möglich. Von diesem Ort der Spontaneität, des Zufalls, des Irrationalen hatte der Gitarrist Simon Jeffes 1972 nach einer überstandenen Fischvergiftung geträumt. Und er wollte ihm hörbare Formen geben. Das gelang ihm mit dem Zusammenschluss eines lockeren Ensembles von etwa zehn Freunden, die auf Gitarre, Cello, Violine, Ukulele, Piano, Klarinette, Oboe, Posaune eine einzigartige Klangwelt zwischen Klassik und Popularmusik schufen. Gegen alle Trends und Stiletikette veröffentlichten die Musiker auf einem Label ihres Förderers Brian Eno präzise getimte Kammermusik, die so eingängig war wie Pop, so loop-verliebt wie Minimal Music und die immer ein Fünkchen britischen Humors in sich trug.
Einmal entwickelte Jeffes ein reizendes kleines Stückchen um ein Telefon-Besetztzeichen herum, ein anderes Mal schrieb er ein Stück für ein Harmonium, dass er in Japan auf der Straße gefunden hatte. Die Inspirationen waren grenzenlos, vom Barock bis zur afrikanischen Trommelwelt, immer organisch, nie elektronisch. Trotzdem – auch das gehört zu den Kuriositäten des Penguin Café Orchestras – hatten sie ihren ersten Live-Auftritt im Vorprogramm von Kraftwerk. Ihre Musik schaffte es in Werbespots der Eurotunnel-Company und von Coop, wurde von DJ Avicii gesampelt.
Als Simon Jeffes 1997 an einem Gehirntumor starb, versuchten die Bandmitglieder es allein, aber schließlich wurde das Café der Pinguine dicht gemacht – bis sich sein Sohn, der Pianist Arthur Jeffes unter dem verkürzten Namen „Penguin Café“ entschloss, die Historie mit neuen Musikern weiterzuschreiben. Seit 2009 hat das imaginäre Café also wieder seine Pforten geöffnet und mittlerweile vier Platten veröffentlicht. Der instrumentalen Kammerpop-Philosophie treu geblieben ist auch die neue Besetzung, die sich aus klassisch ausgebildeten Musikern genauso zusammensetzt wie aus temporären Mitgliedern der Bands Suede und Gorillaz.
Das aktuelle, vierte Werk Handfuls Of Night (Erased Tapes/Indigo) ist das bislang sphärischste und Piano-zentrierteste, und mit ihm betreten Arthur Jeffes‘ und seine Mitstreiter die Antarktis. Was läge näher, mit dem Pinguin als „Wappentier“ des Ensembles? Das dachten sich auch Greenpeace, als sie auf der Suche nach passender Musik im Rahmen einer Fundraising-Kampagne für bedrohte Pinguinarten auf Jeffes zukamen und ihn baten, musikalische Charakterbilder der Seevögel zu gestalten. Es gibt aber noch einen anderen, familiäreren Zusammenhang für Jeffes polare Affinität: Seine Urgroßmutter war in erster Ehe mit dem Forscher Robert Falcon Scott verheiratet, der 1912 nach dem Wettlauf mit dem Norweger Roald Amundsen auf dem Rückweg vom Südpol starb.
Jeffes’ antarktische Soundscapes sind die ideale Background-Musik für eine Welt ohne Winter, in der man die Sehnsucht nach Kälte im heimischen Wohnzimmer auslebt: Seine Widmungen an die Zügel- und Kaiserpinguine sind zart gewebt und haben doch cineastische Breitwandzüge mit warmem Streichergeflecht. Grazil und funkelnd malt er den Tauchgang der Adélie-Pinguine, melancholisch die beschwerliche Wanderung der Tiere durch Fels und Eis. Zu Tastenspiel und Geigen treten sehr dezent Harmonium und Ukulelen-Töne, ruhig, manchmal kaum wahrnehmbar schreiten die Rhythmen unter den melodieverliebten Stücken, ein jazziger Bass tritt da schon fast überraschend hervor. Eingerahmt wird die Suite von zwei Widmungen an das unwirkliche Licht der Mitternachtssonne. Und inmitten all der antarktischen Klangtableaus knüpft Arthur Jeffes auch an die Ära seines Vaters Simon an: Plötzlich ertönt der recycelte Loop jenes Besetztzeichens, das das Penguin Café Orchestra einst so berühmt gemacht hat.
© Stefan Franzen, erschienen in der Badischen Zeitung, Ausgabe 16.01.2020
Penguin Café live:
17.1. Christuskirche Bochum, 21.1. Bogen F Zürich, 22.1. Elbphilharmonie Hamburg, 23.1. Tollhaus Karlsruhe
Penguin Café: NPR Music Tiny Desk Concert
Quelle: youtube


 Dina El Wedidi
Dina El Wedidi Dina El Wedidi geht in ihrer Eisenbahnsuite aber weit über das bloße klangliche Ereignis hinaus. Slumber ist für sie auch eine Reflektion über die Spannung zwischen der Realität und dem Unterbewussten, den Zwischenräumen, die sich während einer nächtlichen Zugfahrt im Halbschlaf öffnen. Ein solcher Zustand ist im lautmalerischen Song „Headache“ eingefangen, ein Dialog zwischen der Außenwelt mit dem Zugrattern, dem Wasserverkäufer vor dem Abteil einerseits, und andererseits den Gedanken im Innern des Kopfes während einer Migräne-Attacke. „Ich meine das natürlich nicht so dramatisch, sondern durchaus mit Humor“, betont Dina El Wedidi lachend. Andere Texte sprechen von den Fesseln, die eine Heimat oder eine Liebe erzeugen können, oder den verschiedenen Zuständen des Gefangenseins, seien sie physisch oder mental.
Dina El Wedidi geht in ihrer Eisenbahnsuite aber weit über das bloße klangliche Ereignis hinaus. Slumber ist für sie auch eine Reflektion über die Spannung zwischen der Realität und dem Unterbewussten, den Zwischenräumen, die sich während einer nächtlichen Zugfahrt im Halbschlaf öffnen. Ein solcher Zustand ist im lautmalerischen Song „Headache“ eingefangen, ein Dialog zwischen der Außenwelt mit dem Zugrattern, dem Wasserverkäufer vor dem Abteil einerseits, und andererseits den Gedanken im Innern des Kopfes während einer Migräne-Attacke. „Ich meine das natürlich nicht so dramatisch, sondern durchaus mit Humor“, betont Dina El Wedidi lachend. Andere Texte sprechen von den Fesseln, die eine Heimat oder eine Liebe erzeugen können, oder den verschiedenen Zuständen des Gefangenseins, seien sie physisch oder mental. Wieder muss der viel zu frühe Tod eines Großen vermeldet werden: Im Alter von 59 Jahren ist am Mittwoch der franko-algerische Sänger und Songwriter Rachid Taha an einem Herzanfall gestorben. Als die Weltmusik noch nicht mal am Horizont erschien, paarte er bereits algerisches Erbe mit Rock’n‘Roll. Rachid Taha, in der Nähe des algerischen Oran 1958 geboren, kommt als Kind bereits mit der Familie nach Frankreich und entwickelt sich als junger Mann zum Querkopf, der gegen die Ressentiments gegenüber den „Beurs“, den maghrebinischen Einwanderern, aufbegehrt. In Lyon arbeitet er in einer Fabrik und koppelt abends als DJ im eigenen Club die Lieder der ägyptischen Diva Oum Kalthoum mit Kraftwerk und Led Zeppelin. „Carte De Séjour“, Aufenthaltserlaubnis, heißt ironischerweise seine erste Band, die 1986 einen Hit mit „Douce France“ haben. Da ist schon der Produzent Steve Hillage auf den jungen Wilden Rachid Taha aufmerksam geworden, er wird über zwanzig Jahre mit ihm arbeiten.
Wieder muss der viel zu frühe Tod eines Großen vermeldet werden: Im Alter von 59 Jahren ist am Mittwoch der franko-algerische Sänger und Songwriter Rachid Taha an einem Herzanfall gestorben. Als die Weltmusik noch nicht mal am Horizont erschien, paarte er bereits algerisches Erbe mit Rock’n‘Roll. Rachid Taha, in der Nähe des algerischen Oran 1958 geboren, kommt als Kind bereits mit der Familie nach Frankreich und entwickelt sich als junger Mann zum Querkopf, der gegen die Ressentiments gegenüber den „Beurs“, den maghrebinischen Einwanderern, aufbegehrt. In Lyon arbeitet er in einer Fabrik und koppelt abends als DJ im eigenen Club die Lieder der ägyptischen Diva Oum Kalthoum mit Kraftwerk und Led Zeppelin. „Carte De Séjour“, Aufenthaltserlaubnis, heißt ironischerweise seine erste Band, die 1986 einen Hit mit „Douce France“ haben. Da ist schon der Produzent Steve Hillage auf den jungen Wilden Rachid Taha aufmerksam geworden, er wird über zwanzig Jahre mit ihm arbeiten.
 Erik West Millette (Québec)
Erik West Millette (Québec)